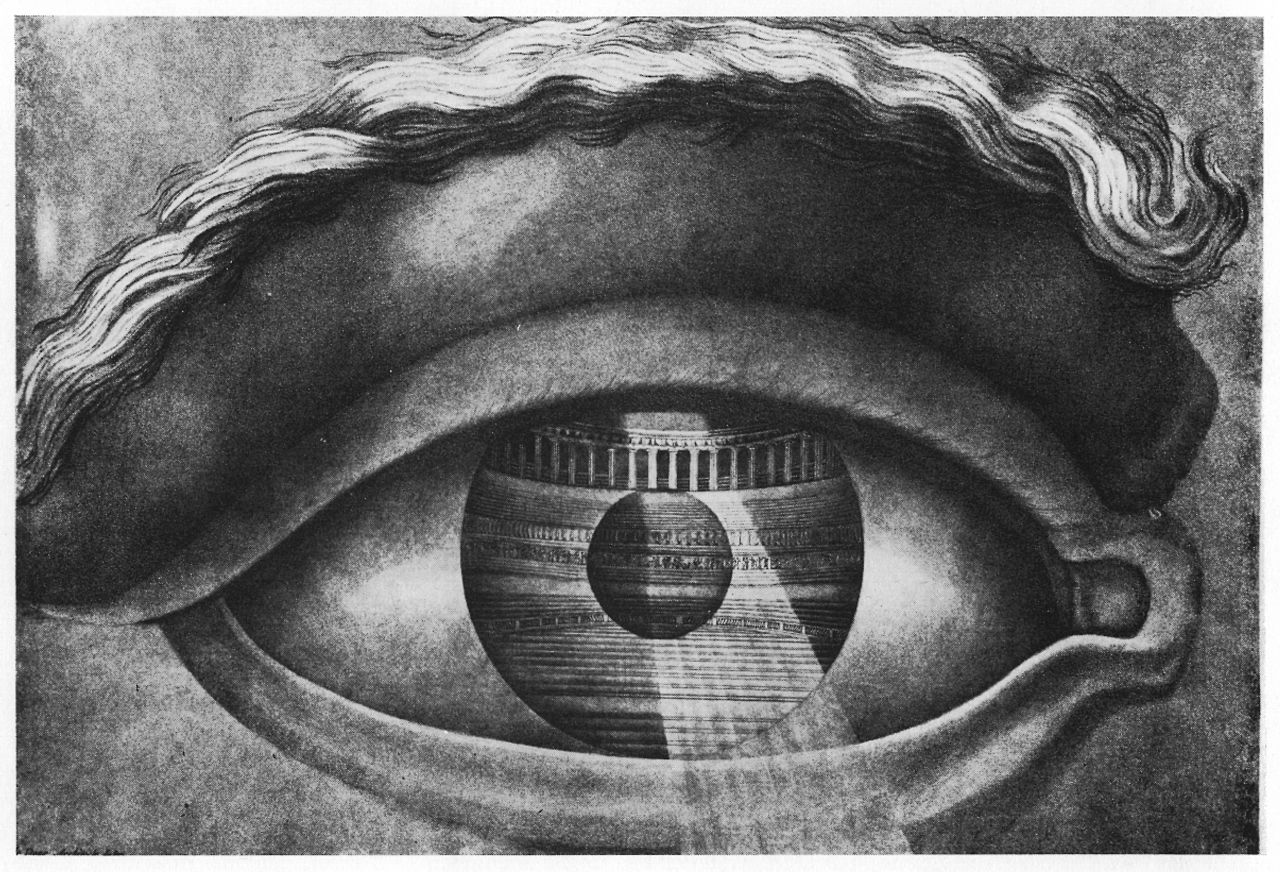Die von Hegel als begleitendes Skript zu seinen Vorlesungen herausgegebene, in späteren Zusätzen durch seine Hörer auf das Doppelte ihres ursprünglichen Umfangs erweiterte Zusammenfassung des (subiectivus und obiectivus) Deutschen Idealismus stellt Hegels Überblick über sein philosophisches System dar. Zugleich ist sie ein Panorama der Welt in ihren Abteilungen Logik (Sein – Wesen – Idee), Natur und Geist (subjektiver, objektiver und absoluter Geist). Darin fasst sich der Anspruch der Hegelschen Philosophie zusammen, alle Erscheinungen und das Wesen der Wirklichkeit in ihrem Zusammenhang zu erfassen. Dass das „Wahre […] das Ganze“ sei, wie 1807 in der Phänomenologie des Geistes (Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 24) postuliert, ist nicht als (unabschließbare) quantitative Addition aller Einzelheiten zu verstehen, sondern als (abgeschlossene) begriffliche Bestimmung, also als qualitativer Begriff des Zusammenhangs aller Einzelheiten. Als „Totalität“ lebt diese Vorstellung bis hin zu ihrer Negation in der Kritischen Theorie fort. – Carsten Jakobi
Literatur / Quellen:
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Phänomenologie des Geistes [1807], Frankfurt am Main: Suhrkamp 1986
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften [1801–1830], Frankfurt am Main: Suhrkamp 1995
Weblinks:
🖙 Wikipedia
🖙 Online-Text