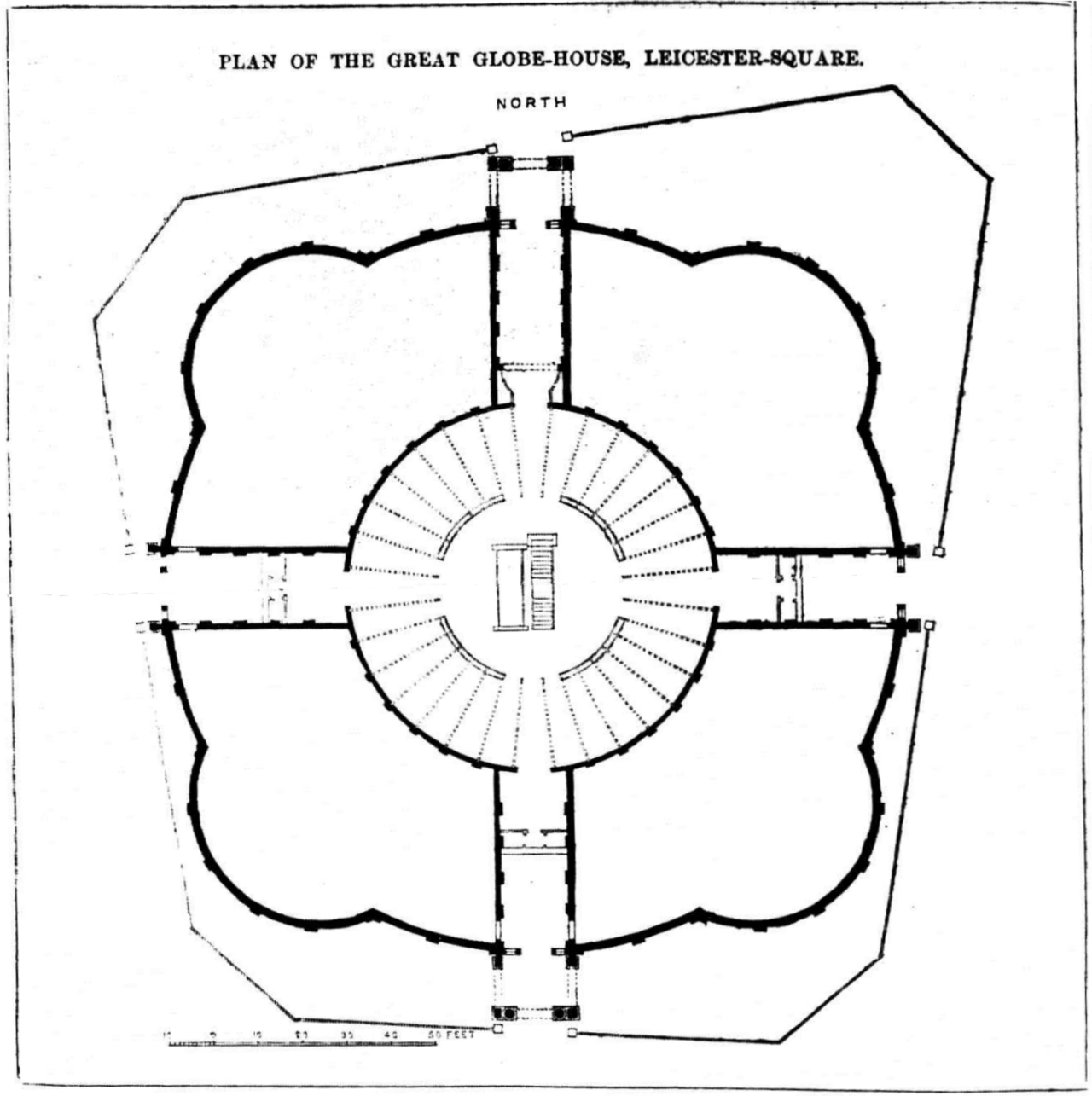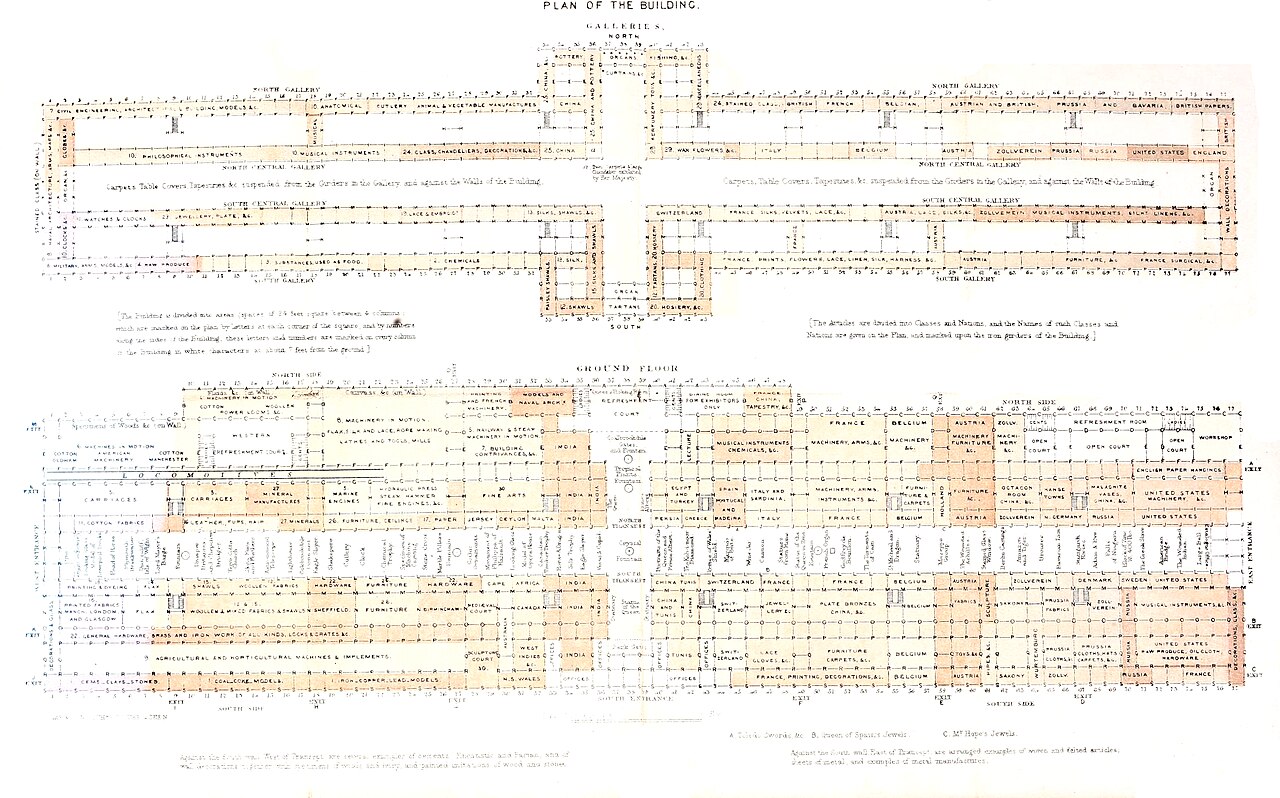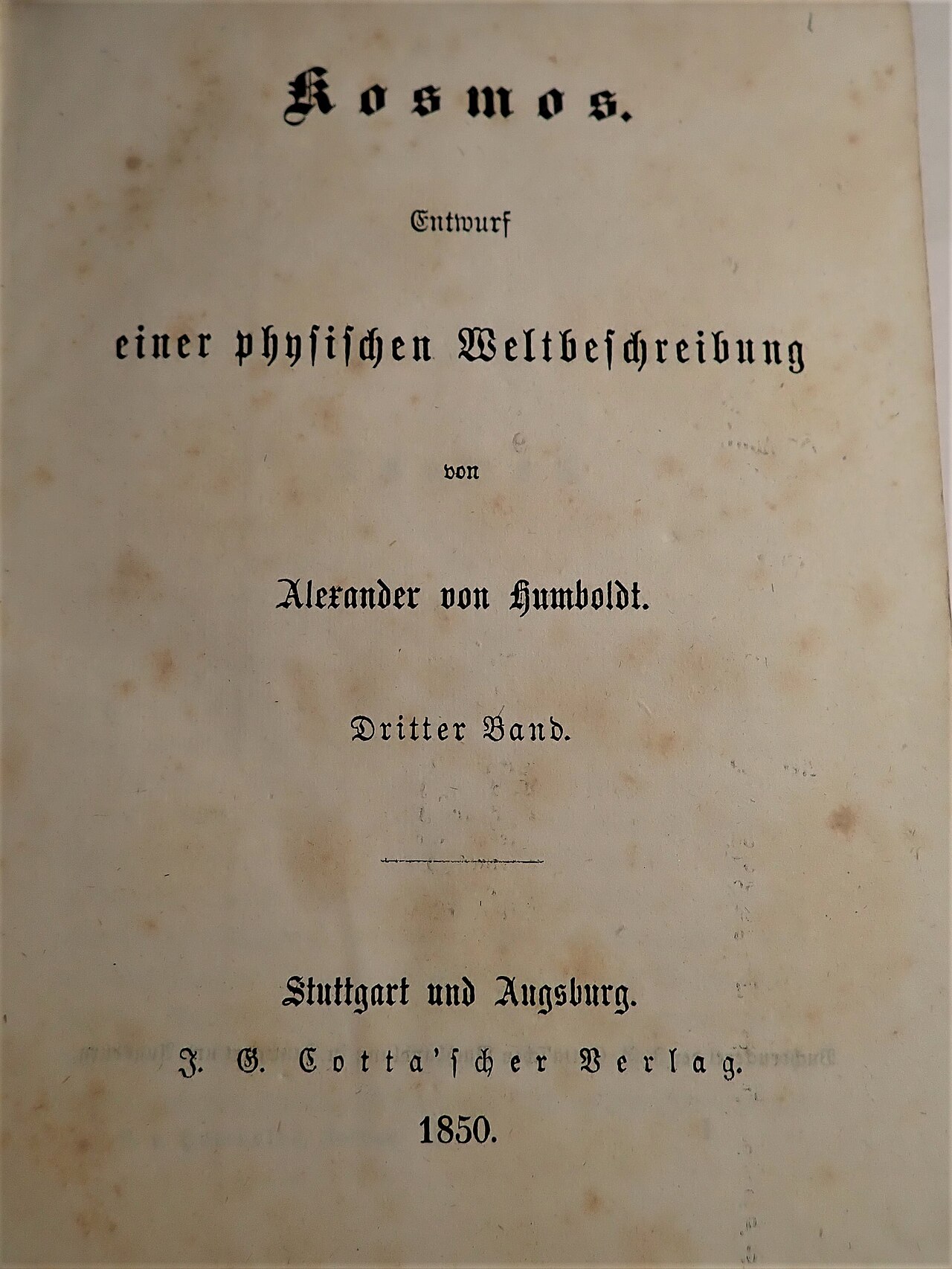1840 als literarisches Debüt des Autors veröffentlicht, schildert Stifters Erzählung die zerbrochene Jugendliebe des Malers Gustav und der emanzipationswilligen Cornelia. Im Zentrum des an Jean Pauls Ballon-Motivik anknüpfenden Werks steht der Konflikt um Cornelias entgegen Gustavs Warnung unternommene Ballonfahrt über die Alpen. Allerdings erweist sich die Höhenerfahrung für Cornelia als überfordernd: „Erschrocken wandte die Jungfrau ihr Auge zurück, als hätte sie ein Ungeheuer erblickt – aber auch um das Schiff herum wallten weithin weiße, dünne, sich dehnende und regende Leichentücher – von der Erde gesehen – Silberschäfchen des Himmels. – Zu diesem Himmel floh nun ihr Blick – aber siehe, er war gar nicht mehr da: das ganze Himmelsgewölbe, die schöne blaue Glocke unserer Erde, war ein ganz schwarzer Abgrund geworden, ohne Maß und Grenze in die Tiefe gehend.“ (Riha (Hg.) Reisen im Luftmeer, S. 69). Als Cornelia schließlich in Ohnmacht fällt, muss die kostspielige Fahrt abgebrochen werden: „‚Wir müssen niedergehen; die Lady ist sehr unwohl.‘ Der alte Mann stand auf von den Instrumenten und sah hin, es war ein Blick voll strahlenden Zornes, und ein tief entrüstetes Antlitz. Mit überraschend starker Stimme rief er aus: ‚Ich habe es dir gesagt, Richard, das Weib erträgt den Himmel nicht –.‘“ (Riha (Hg.) Reisen im Luftmeer, S. 170). Der in Stifters fiktiver Handlungskonstellation nahegelegte weibliche Mangel an celestischer Panorama-Akkommodationsfähigkeit (vgl. etwa auch Riha (Hg.) Reisen im Luftmeer, S. 116), der in der Realgeschichte der Ballonfahrt nicht signifikant zu belegen ist (eher im Gegenteil, vgl. Riha (Hg.) Reisen im Luftmeer, zum Beispiel, S. 125), ebenso wenig wie umgekehrt etwa eine pauschale weibliche Sensibilität für die abgründige Erhabenheit kosmischer Seheindrücke, gibt Anlass zur Diskussion historischer Gender-Stereotype, wie sie analog auch im Diskurs um angebliche Überforderungssymptome von Frauen und Kindern beim Panorama-Besuch auftreten. – Naemi Dittes | Johannes Ullmaier
Literatur / Quellen:
- Stifter, Adalbert: Studien 1. Sämtliche Werke, Bd. I, Prag: Calve 1904
- Riha, Karl (Hg.): Reisen im Luftmeer. Ein Lesebuch zur Geschichte der Ballonfahrt, München/Wien: Hanser 1983, S. 161–170
Weblinks:
🖙 Wikipedia
🖙 Springer Link