Interaktive Amsterdamer Medieninstallation zu Comenius’ didaktischem Gesamtkompendium von 1658. – Johannes Ullmaier
1993 – Ausstellung Sehsucht – Das Panorama als Massenunterhaltung des 19. Jahrhunderts
In der Kunst- und Ausstellungshalle der BRD in Bonn findet die bislang profundeste und reichhaltigste Einzelschau zur Geschichte und technischen Faktur panoramatischer Medien vom späten 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert statt. Der dazu erschienene Katalog ist bis heute das materialreichste Einzelkompendium zum Thema. – Johannes Ullmaier
Literatur / Quellen:
- Plessen, Marie-Louise von/Giersch, Ulrich (Hgg.): Sehsucht. Das Panorama als Massenunterhaltung des 19. Jahrhunderts, Frankfurt am Main: Stroemfeld / Roter Stern 1993
1993 – Randy Rogel, Yakko’s World im Cartoon Animaniacs
Das Lied Yakko’s World ist ein Versuch, alle Länder der Welt aufzuzählen. Die Cartoon-Figur Yakko, der Rob Paulsen im Englischen die Stimme leiht, singt in unter zwei Minuten vier Strophen, deren Text beinahe ausschließlich aus Ländernamen besteht. Die restlichen Worte dienen primär der Einhaltung des Rhythmus, liefern jedoch stellenweise sogar kurze Informationsschnipsel zu den genannten Ländern mit – so beispielsweise der Vers „And Germany, now in one piece“, der auf die zum Veröffentlichungszeitpunkt erst kürzlich erfolgte deutsche Wiedervereinigung verweist. Das Lied stellt die Namen größtenteils nach Kontinenten geordnet vor und wird im Cartoon von Yakko anhand einer Weltkarte veranschaulicht. Problematisch ist die kaum vermeidliche Verjährung dieser medialen All-Erfassung: Alte Staaten lösen sich auf, neue entstehen. So verliert der Liedext im Laufe der Zeit (so wie zuvor schon Tom Lehrers Periodentafel-Komplett-Aufzählung The Elements) seinen panoramatischen Komplettheitsanspruch. Um dem entgegenzuwirken, wird der Text Jahre nach seinem Erscheinen von Rogel überarbeitet und eine weitere Strophe hinzugefügt. Das grundsätzliche Problem ist damit nicht beseitigt, aber aufgeschoben. Um sie weiter aktuell zu halten, muss Yakko seine Welt konstant beobachten. – Annika Bäurer
Weblinks:
1990–2003 – DNA- Gesamterfassung, Human Genome Project
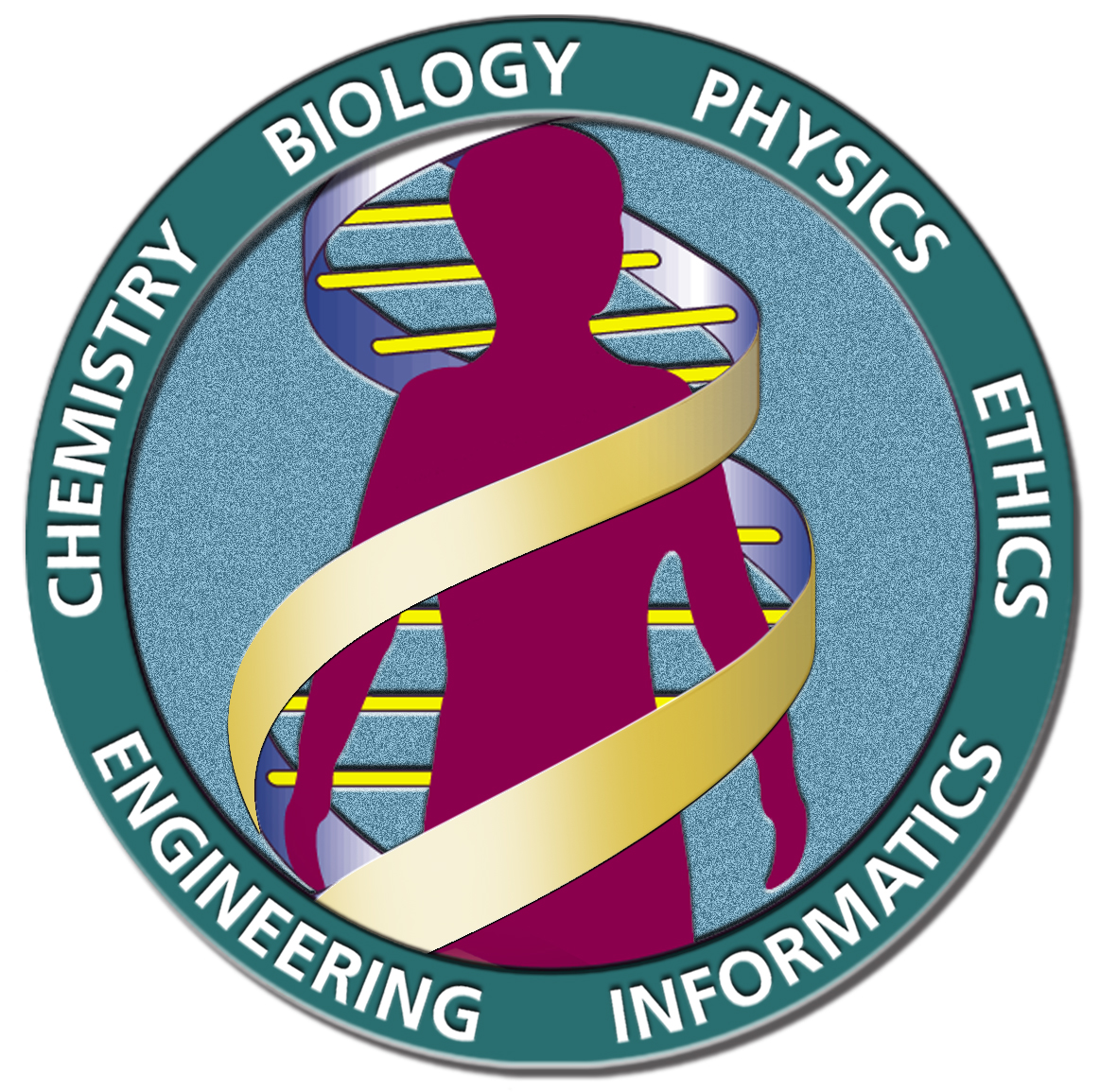
Das Human Genome Project (HGP) stellt ein innerhalb der Genetik bahnbrechendes Forschungsprojekt dar, welches das Ziel der erstmaligen vollständigen Sequenzierung der Basen des menschlichen Genoms verfolgt. Es verbindet biologische Forschung mit den rasanten informationstechnischen Fortschritten der Zeit, indem schier unvorstellbare Datenmengen digital und global verarbeitet, analysiert und vernetzt werden. Finanziert durch die National Institutes of Health der Vereinigten Staaten und in internationaler Kooperation mit Forschungsinstituten in Japan, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und China wird im Jahr 2003 ein Arbeitsentwurf veröffentlicht, der 92 % der Abfolge der ca. drei Milliarden Basenpaare auf den Chromosomen der menschlichen DNA enthält. Die verbleibenden Lücken sind auf die zu diesem Zeitpunkt noch beschränkten technischen Möglichkeiten zurückzuführen. Erst durch Anschlussprojekte, welche im März 2022 durchgeführt werden, erzielt man schließlich eine komplette Sequenzierung der genetischen Struktur. Durch die Errungenschaften des Projekts bricht eine neue Ära der biologischen Forschung an: „the shelf life of the scientific tool produced by the HGP is, effectively, forever.“ (Collins et al., „The Human Genome Project“, S. 286). „[I]t is simply inconceivable today that we would not have the genome at our fingertips.“ (Gibbs, „The Human Genome Project“, S. 575). – Bianka Niebling
Literatur / Quellen:
- Collins, Francis S.: „The Human Genome Project: Lessons from Large-Scale Biology“. In: Science 300 (2003), S. 286–290
- Gibbs, R.A.: „The Human Genome Project changed everything“. In: Nature Reviews Genetics 21 (2020), S. 575–576
Weblinks:
🖙 Human Genome Project, US Department of Energy
🖙 National Human Genome Research Institute
1987 – Kindergedenkstätte in Yad Vashem
In der von Moshe Safdie entworfenen Kindergedenkstätte in Yad Vashem liegt ein begehbarer, komplett verspiegelter Hauptraum, in dem fünf Kerzen vielfach reflektiert werden und so die mindestens 1,5 Mio. jüngsten Opfer der Shoah symbolisieren. Alle bekannten Namen der ermordeten Kinder werden dort von einem Endlostonband vorgetragen. (Ebenfalls in Yad Vashem befindet sich das sogenannte Partisanen-Panorama, das jedoch keine prägnant panoramatische Struktur aufweist). – Rebecca Rasp
Literatur / Quellen:
- Gutterman, Bella/Shalev, Avner: Zeugnisse des Holocaust, Göttingen: Wallstein 2006, S. 312
Weblinks:
1985 – Katalog-Anthologie Alles und noch viel mehr
Tausendseitige Ausstellungs- und (Kunst-)Epochendokumentation mit sehr weitgespanntem Spektrum, das von „Bild + Text“ über „Song/Audio“ oder „Szene/Drama“ bis zu „Zeichen“ oder „Philosophie“ reicht. Alle Sektionen sind einem Buchstaben des Alphabets zugeordnet, wenngleich außer bei „V“ für „Video“ keine Übereinstimmung mit den Rubrikennamen herrscht. Auch läuft das Alphabet nicht wie gewohnt von A bis Z durchs Buch, sondern – quasi als Rundkette – von X bis Z und dann von A bis W. In der Präambel reflektiert der Herausgeber die Dialektik allumgreifender Bestrebungen: „Der Sinn von ALLES UND NOCH VIEL MEHR liegt darin, einmal das kreative Potential vereint zu zeigen […]. Es scheint mehr zu sein, als es tatsächlich ist, und ist plötzlich tatsächlich mehr. […] Bei ALLES UND NOCH VIEL MEHR handelt es sich um das VIEL MEHR, ein überschwängliches, systemsprengendes, luxuriöses Moment, wie in der anderen Richtung um das ETWAS, das WENIG oder gar das NICHTS, welches die zwanghaften Grenzen des ALLES überschreitet. Denn ALLES ist der Totalitarismus der Macht, der die zentralistische Lenkung perfektioniert und Einverleibungen durch klare Grenzziehung markiert. ALLES ist der Wahn der absoluten Kontrolle, des Gleichschritts und der Nivellierung des Heterogenen […], der Anspruch des reinen Wissens, das […] weder eine sinnvolle Selbstbeschreibung kennt noch den Flug der Gedanken, welche das VIEL MEHR charakterisieren.“ (Lischka (Hg.), Alles und noch viel mehr, S. 7). – Johannes Ullmaier
Literatur / Quellen:
- Lischka, Gerhard Johann (Hg.): Alles und noch viel mehr. Das poetische ABC, Bern: Bentelli 1985
Weblinks:
1982 – Videospielreihe, Microsoft Flighstimulator
Die Videospielreihe Microsoft Flightsimulator verspricht seit 1982, via Flugsimulation über den eigenen Heimcomputer möglichst realistisch an jeden Ort der Welt gelangen zu können. Die erste Version konnte lediglich acht Fluginstrumente und eine 2D Ebene darstellen. Demgegenüber benutzt der nunmehr zwölfte Ableger der Videospielreihe, der Microsoft Flight Simulator 2024, fortgeschrittene Methoden, um die gesamte Erde darzustellen. Zum einen setzt er per Algorithmus vorgefertigte Häuser, Straßen oder Bäume an jene Stellen in der digitalen Welt, wo sie auf der Onlinekarte von Bing zu finden sind. Zum anderen benutzt er bei größeren Städten Photogrammetrie (eine Technik, bei der durch die Analyse und Vermessung von Fotografien virtuelle 3D-Gebäude erstellt werden). Die höchste Stufe der Detailtreue lässt sich im Simulator jedoch dann finden, wenn Flughäfen oder Sehenswürdigkeiten per Hand (also nicht über einen Algorithmus) von einem Entwicklerteam digital nachgebaut wurden. Das Hauptentwicklerteam Asobo stattet den Simulator zusätzlich kontinuierlich mit „World Updates“ aus. Insgesamt beträgt die Größe dieser digitalen Welt über zwei Millionen Gigabyte. Um diese Datenmenge für einen Heimcomputer nutzbar zu machen, lädt der PC immer nur die Landschaften von einem Server herunter, die gerade in Reichweite des virtuellen Flugzeugs sind. Je nach Region schwankt der Detaillierungsgrad, sodass eine Person aus Wien sein/ihr Haus genau erkennen kann, wohingegen eine Person aus Damphu (Dorf im Buthan) im Flugsimulator nur auf ein generisches Haus trifft. Wer eine eigene Haustür hat, kann aber trotzdem davor landen, egal auf welchem Punkt der Erde – man muss nur das passende Luftfahrzeug wählen. – Till Bertram
Weblinks:
1977 – Ludwig Marcuse, Ein Panorama europäischen Geistes
Unter dem Titel Texte aus drei Jahrtausenden kuratiert Ludwig Marcuse (1894–1971) ab 1959 im Bayerischen Rundfunk eine wöchentliche Sendereihe. Auf deren Basis veröffentlicht Gerhard Szczesny sechs Jahre nach dessen Ableben eine dreibändige Textauswahl mit dem neuen Titel Panorama europäischen Geistes (und dem alten Titel als Untertitel), die in chronologischer Reihenfolge auf ca. 1200 Seiten 122 Ausschnitte aus Kerntexten berühmter Figuren der Geistesgeschichte darbietet: Bd 1: Von Diogenes bis Plotin, Bd. 2: Von Augustinus bis Hegel, und Bd. 3: Von Karl Marx bis Thomas Mann. Damit wird der Versuch unternommen, der Leserschaft eine möglichst weitgespannte, aber zugleich begrenzte Vorauswahl der bedeutungsvollsten Schriften und Autoren zu bieten. Der (nirgends näher erläuterte) ‚Panorama‘-Titel beansprucht hier ausdrücklich nicht, eine allumfassende Darstellung des „europäischen Geistes“ zu liefern. Vielmehr soll das Kompendium laut Szczesnys kurzer „Vorbemerkung“ (vgl. Marcuse, Panorama, Bd. 1, S. 9–13) eine niedrigschwellige Möglichkeit zur ersten Lektüre schaffen, die der Leser im Anschluss selbstständig vertiefen kann. Beginnend mit dem Buch Hiob bis hin zu Thomas Manns Bruder Hitler wird jeder Textausschnitt von einer kurzen Kontext/Autor/Werk-Charakteristik aus Marcuses Feder eingeführt. Indem sie dessen universalen Geist ebenso wie seinen grundsätzlichem Pessimismus wiederspiegelt, möchte die Sammlung veranschaulichen, dass die Menschheit sich seit Anbeginn in der Literatur, der Wissenschaft und der Philosophie unentwegt darin versucht, „immer wieder die gleichen letzten, vorletzten und vorvorletzten Fragen zu lösen“ (S. 10).
Darüberhinaus reflektiert Szczesny auch die buchmediale Grenzstellung des Kompendiums zwischen einem zugriffspanoramatischen Zugang frei flanierenden Herumschmökerns einerseits und der im Doppelsinn erschöpfenden, dafür aber die volle Breite und Tiefe ausschöpfenden laufpanoramatischen Gesamterschließung: „Im allgemeinen wird man dem Leser eines so umfangreichen Breviers mit Recht empfehlen, nicht Seite für Seite zu studieren, sondern nach Lust und Laune darin zu blättern. Wer es sich zeitlich leisten kann, sollte die drei Bände aber auch einmal als ganze und in einem Zug zu lesen versuchen. Es wird sich ihm dann eine ebenso spannende wie bewegende Szenerie öffnen. […] Wenn man auf solche Weise einen Teil der aktenkundig gewordenen Geschichte des homo sapiens an sich vorüberziehen lässt, stellen sich zwei Erlebnisse ein: Die Erfahrung der tatsächlich überwältigenden Vielfalt menschlichen Denkens und Trachtens und des Erlebnisses des Eingebettetseins der eigenen, sehr peripheren und verlorenen Existenz in diesen sich in ferner Vergangenheit verlierenden Strom von Menschen und Schicksalen, Träumen und Alpträumen, geglückten und gescheiterten Unternehmungen.“ (Bd. 1, S. 12/13) – Niclas Stahlhofen / Johannes Ullmaier
Literatur / Quellen:
- Marcuse, Ludwig: Ein Panorama europäischen Geistes. Texte aus drei Jahrtausenden, Zürich: Diogenes 1977.
1976 – Peter Handke, Notizbücher / Das Gewicht der Welt
Dass Autoren Einfälle, Beobachtungen und Formulierungen in mitgeführten Kladden festhalten, um sie in ihre Werke einzuarbeiten, ist nicht ungewöhnlich. Auch Peter Handke tut das früh. Um Mitte der 1970er-Jahre intensiviert und autonomisiert sich dieses Aufschreiben bei ihm jedoch zu einem tagtäglichen Mitschreiben der eigenen Welterfahrungsspur, was sich als perzeptive Einstellung fortan verstetigt und im einzelnen Notat verdichtet. Ab März 1976 begreift er diesen Schreibpfad selbst als genuines und zentrales Werk, „mein persönliches Epos“ (Handke, Das Gewicht der Welt, S. NB12, 44). Bis 2025 füllt es weit über zweihundert umfängliche Notizbücher. Im Juni 2024 werden die ersten 21 davon, die den Zeitraum von März 1976 bis November 1979 umfassen, als Online-Edition veröffentlicht. Im Weiteren sollen zunächst die folgenden 26 (1979–1986) der 75 bis zum Juli 1990 entstandenen Bucheinheiten jeweils sowohl in ihrer handschriftlichen Originalgestalt als auch transkribiert und kommentiert zugänglich werden, letztlich aber alle dieser (bis heute fortgeführten) Aufzeichnungen. Aus der Chronik der laufenden Berührung von umgebender und innerer Wirklichkeit, von Augen, Kopf und Körper, Hand, Stift, Blatt und Buch erwächst eine dichte „Reportage“ von Bewusstseins-Ereignissen aller Art (Handke, Das Gewicht der Welt, S. 6), in deren – am Anfang so privater wie am Ende weltweit öffentlicher – Form der Literaturnobelpreisträger von 2019 Das Gewicht der Welt erfährt. Unter letzterem Titel und dem Untertitel Ein Journal (November 1975 – März 1977) erscheint 1977 bereits ein erstes Buch, das diese Schreibpraxis publik macht und den Übergang vom Werknotizkompendium zum Weltregistraturmedium markiert. Neben autonomen Notaten und Alltagsprotokollen, etwa von einem Aufenthalt im Krankenhaus, enthält es zugleich Arbeitsjournal-Vermerke für die 1976 erschienene und im Jahr darauf verfilmte Erzählung Die linkshändige Frau. Spätere Journal-Buchpublikationen wie Die Geschichte des Bleistifts (1982), Phantasien der Wiederholung (1983), Am Felsfenster morgens (1998), Gestern unterwegs (2005), Ein Jahr aus der Nacht gesprochen (2010) und Vor der Baumschattenwand nachts (2016) gehören dem Notizsektor von vornherein zu und bilden in der Werkausgabe von 2018 folgerichtig eine eigene Sektion, der auch die anschließend noch erschienenen Innere Dialoge an den Rändern. 2016–2021 (Handke, Innere Dialoge) zuzuzählen wären. Zwar enthalten auch diese gedruckten Notizensammlungen weiterhin Werknotizen, allerdings nun eingebettet in den großen Strom. Dass sie weder in Material noch Form mit den zugrundeliegenden Notizbüchern identisch sind, zeigt sich eindrücklich im Abgleich mit der Printpublikation eines der Originalhefte (Handke, Die Zeit und die Räume) parallel zu deren Online-Präsentation. – Katharina Pektor / Johannes Ullmaier
Literatur / Quellen:
- Handke, Peter: Das Gewicht der Welt. Ein Journal (November 1975 – März 1977), Salzburg: Residenz 1977
- Handke, Peter: Journale. 3 Bde., Berlin: Suhrkamp 2018
- Handke, Peter: Innere Dialoge an den Rändern. 2016–2021, Salzburg/Wien: Jung und Jung 2022
- Handke, Peter: Die Zeit und die Räume. Notizbuch 24. April – 26. August 1978, Berlin: Suhrkamp 2022
- Pektor, Katharina: „Leuchtende Fragmente. Über Peter Handkes Notizbücher und Journale“. In: „Das Wort sei gewagt“. Ein Symposium zum Werk von Peter Handke, hg. von Attila Bombitz und Katharina Pektor, Wien: Praesens 2019, S. 253–287
Weblinks:
1975 – Dieter Roth, Zeitschrift für Alles / Review for Everything / Tímarit fyrir Allt
Programmatisch heisst es in der ersten Nummer: „Review For Everything accepts and publishes everything that is submitted. Up to 4 pages from each contributor.“ Ohne Ansehen von Inhalt, Form, Sprache, Qualität oder Prominenz publiziert Dieter Roths Printorgan ab 1975 über zehn prallvolle Ausgaben hinweg (so gut wie) alles, was dort eingesandt wird – und liegt damit gemessen am Schnitt dessen, was zeitgleich oder später insgesamt an Zeitschriften erscheint, auf der Qualitätsskala weit oben. Nachdem die Nummer 10 (1987) schon zwei Teilbände braucht, wird selbst Roth – als wohl größter Copia-Künstler der Moderne – der Fülle nicht mehr Herr und muss die Zeitschrift einstellen. – Johannes Ullmaier
Literatur / Quellen:
- Roth, Dieter (Hg.): Zeitschrift für Alles / Review for Everything / Tímarit fyrir Allt, Basel/Stuttgart: Dieter Roth Verlag/Edition Hansjörg Meyer 1975