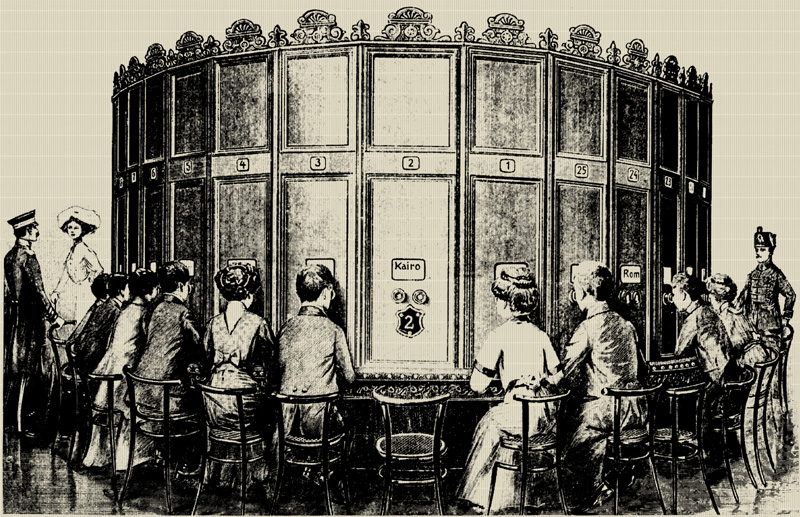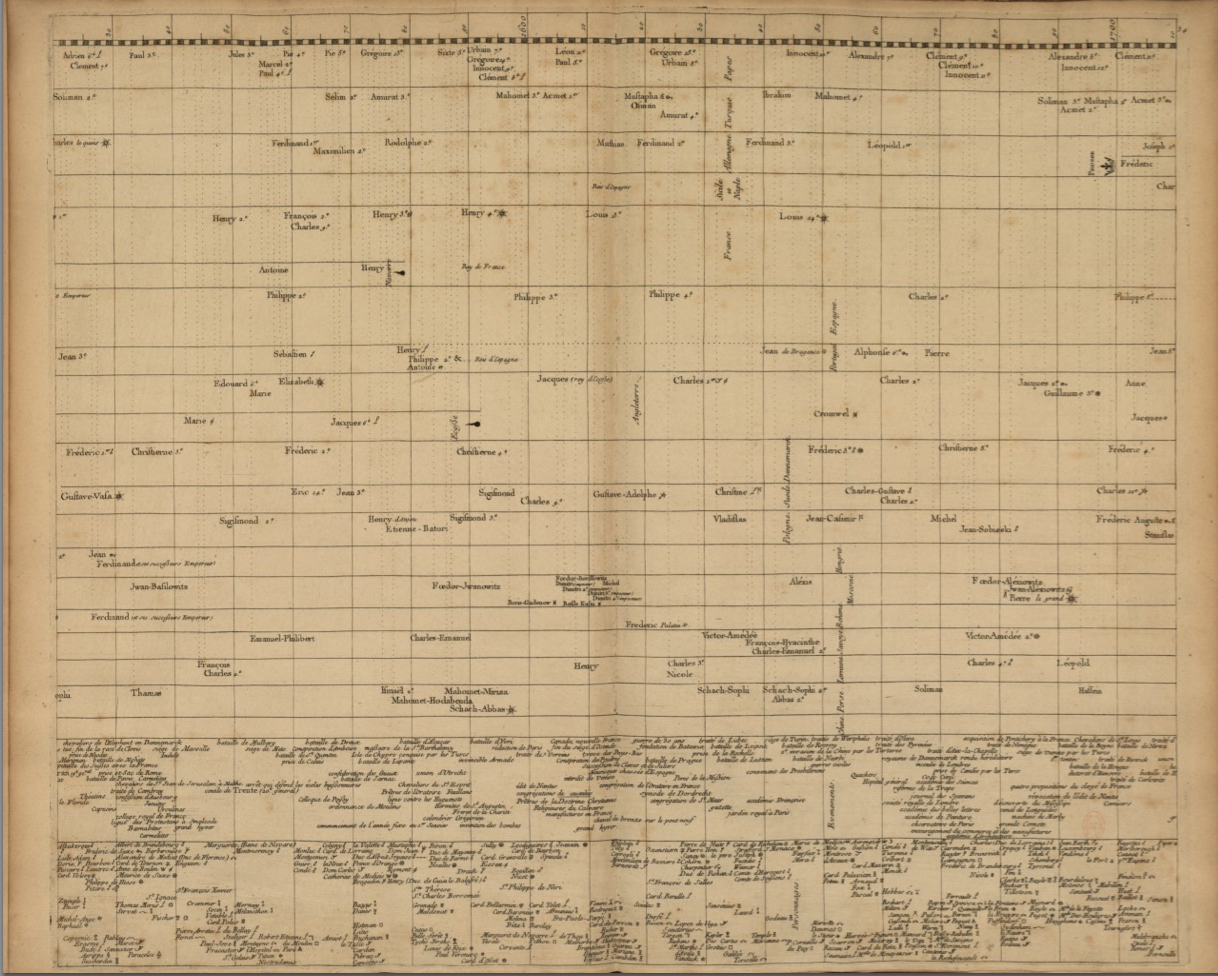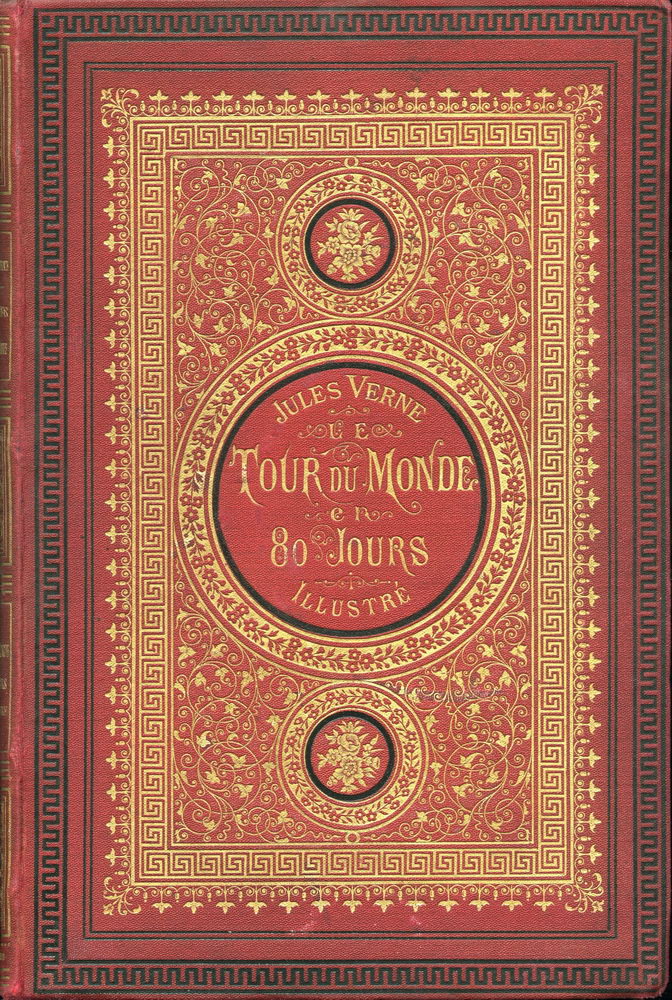
Realgeschichtlicher Bezugspunkt für Vernes Erfolgsroman ist die Reise des Amerikaners George Francis Train, der 1870 in 80 Tagen die Erde umrundete. Der fiktive Romanheld, der Brite Phileas Fogg, der nicht gern verreist, wettet 1872 in seinem Herrenclub 20.000 Pfund darauf, dass es ihm gelingt, in 80 Tagen einmal um die Erde zu gelangen. Mit seinem Diener Passepartout reist er mithilfe moderner Transportmittel wie Dampfschiff und Eisenbahn, aber auch per Elefant oder zu Fuß. Dabei erlebt er unablässig Abenteuer und Attraktionen, die sich in ihrer rasanten Abfolge wie der Pionierlauf zu einer panorama-touristischen Sightseeing-Weltreise ausnehmen und Affinitäten zu zeitgleichen Moving-Panorama-Shows aufweisen. Spannungsmoment ist der ständige Wettkampf gegen die Zeit und mannigfache Hindernisse. Nach knapp über 80 Tagen erlebter Fahrtdauer erreicht Fogg wieder seinen Londoner Herrenclub – im Glauben, die Wette verloren zu haben. Als Folge der Erdumrundung gen Osten und der daraus resultierenden Zeitverschiebung hat Fogg aber einen Kalendertag und somit auch die Wette gewonnen. – Naemi Dittes | Johannes Ullmaier
Literatur / Quellen:
- Verne, Jules: Reise um die Erde in achtzig Tagen [1873], Zürich: Diogenes 1973