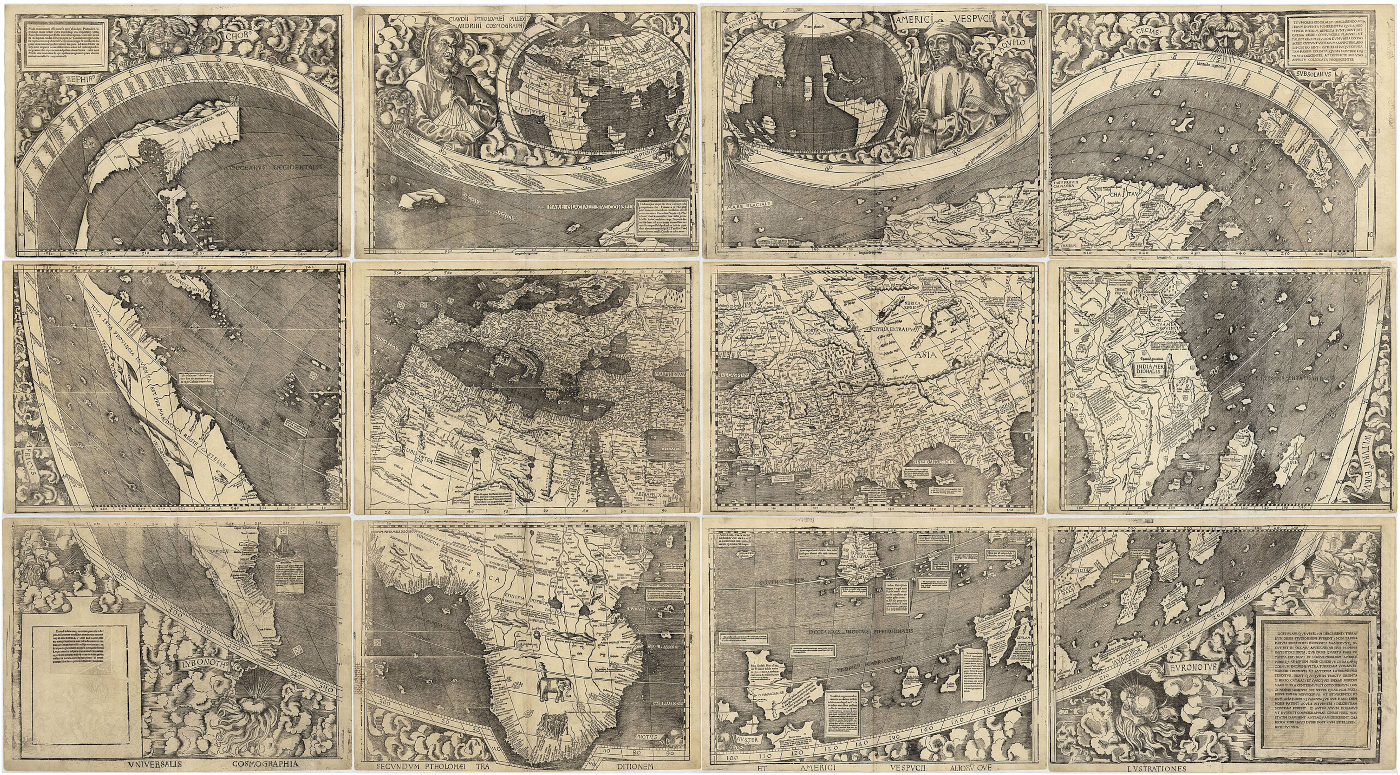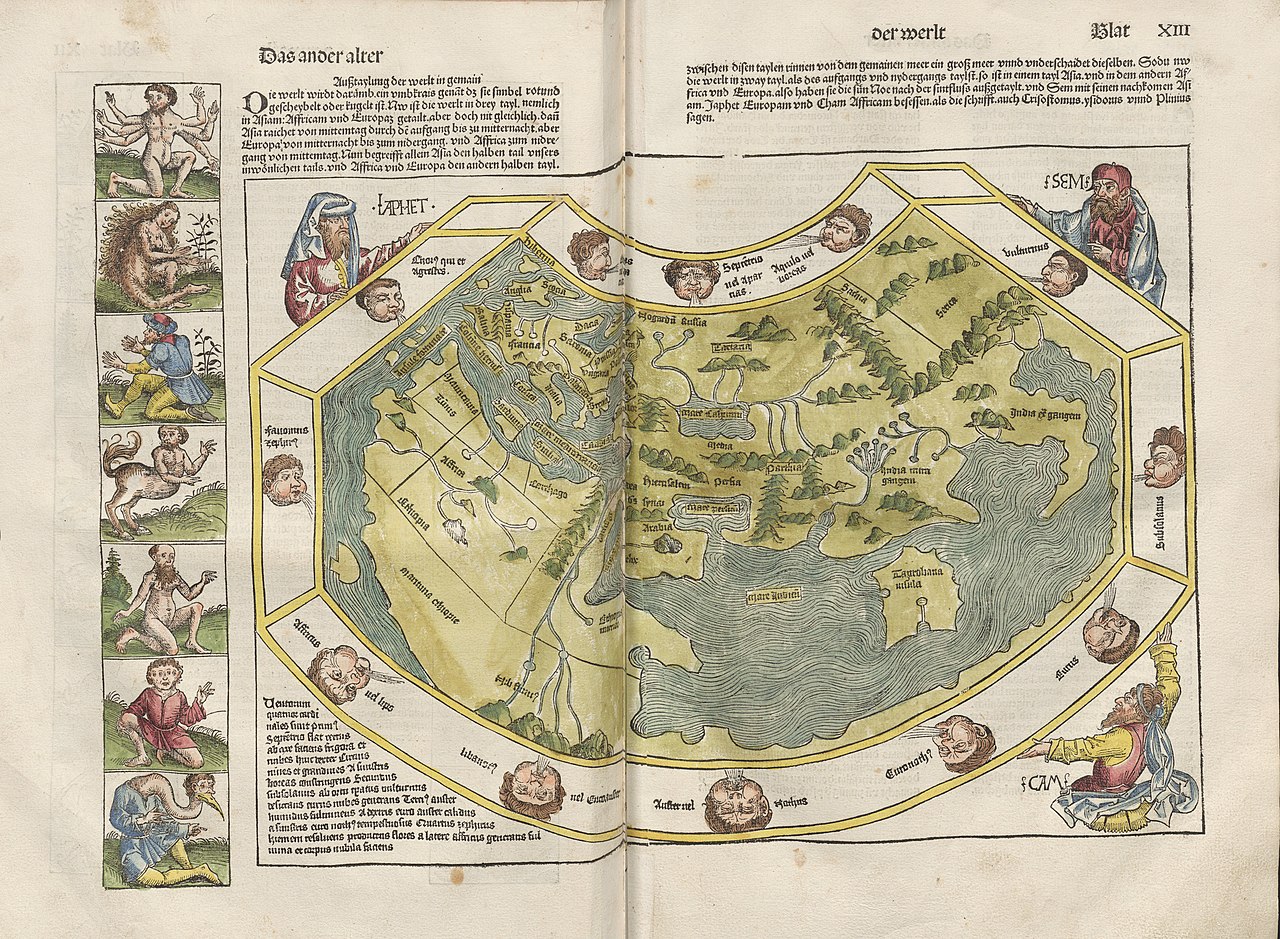In der Forschungsliteratur zum Maler Pieter Bruegel d.Ä. werden häufig insbesondere dessen Bilder aus den späten 1550er-Jahren als ‚Wimmelbilder‘ bezeichnet, so auch Kinderspiele. Als Merkmale hierfür gelten Sabine Pénot und Elke Oberthaler der hochgelegte Horizont und die sich daraus ergebende starke Aufsicht auf das Geschehen sowie „die überbordende Anzahl an Staffagefiguren, die beinahe ohne Überschneidungen ihrer Wertigkeit auf der gesamten Bildfläche angeordnet sind, sowie der enzyklopädische Ansatz“ (vgl. Pénot/Oberthaler, „Kinderspiele“, S. 132). Mit letzterem ist in diesem Fall die Darstellung von rund neunzig Kinderspielen gemeint, die Bruegel auf einem Bild so versammelt, als würden diese alle zur gleichen Zeit im öffentlichen Raum einer Stadt stattfinden. Es ist nicht geklärt, ob diese Darstellung eher allegorischen Gehalt hat oder von dem mimetischen Anspruch auf eine lebendige Gesamt-Repräsentation der Vielfalt kindlichen Spiels her verstanden werden muss. Weitere bekannte Beispiele dieser Art von Bildern Bruegels sind etwa Bauernhochzeit (um 1568) und Kampf zwischen Karneval und Fasten (um 1559). – Clara Wörsdörfer
Literatur / Quellen:
- Pénot, Sabine/Oberthaler, Elke: „[Kat.-Nr. 50] Kinderspiele“. In: Bruegel. Die Hand des Meisters, Ausst.-Kat. Wien, Kunsthistorisches Museum, hg. von Sabine Haag, Stuttgart: Belser 2019, S. 130–134
- Pochat, Götz: Bild – Zeit. Zeitgestalt und Erzählstruktur in der bildenden Kunst des 16. Jahrhunderts, Wien/Köln/Weimar: Böhlau 2015