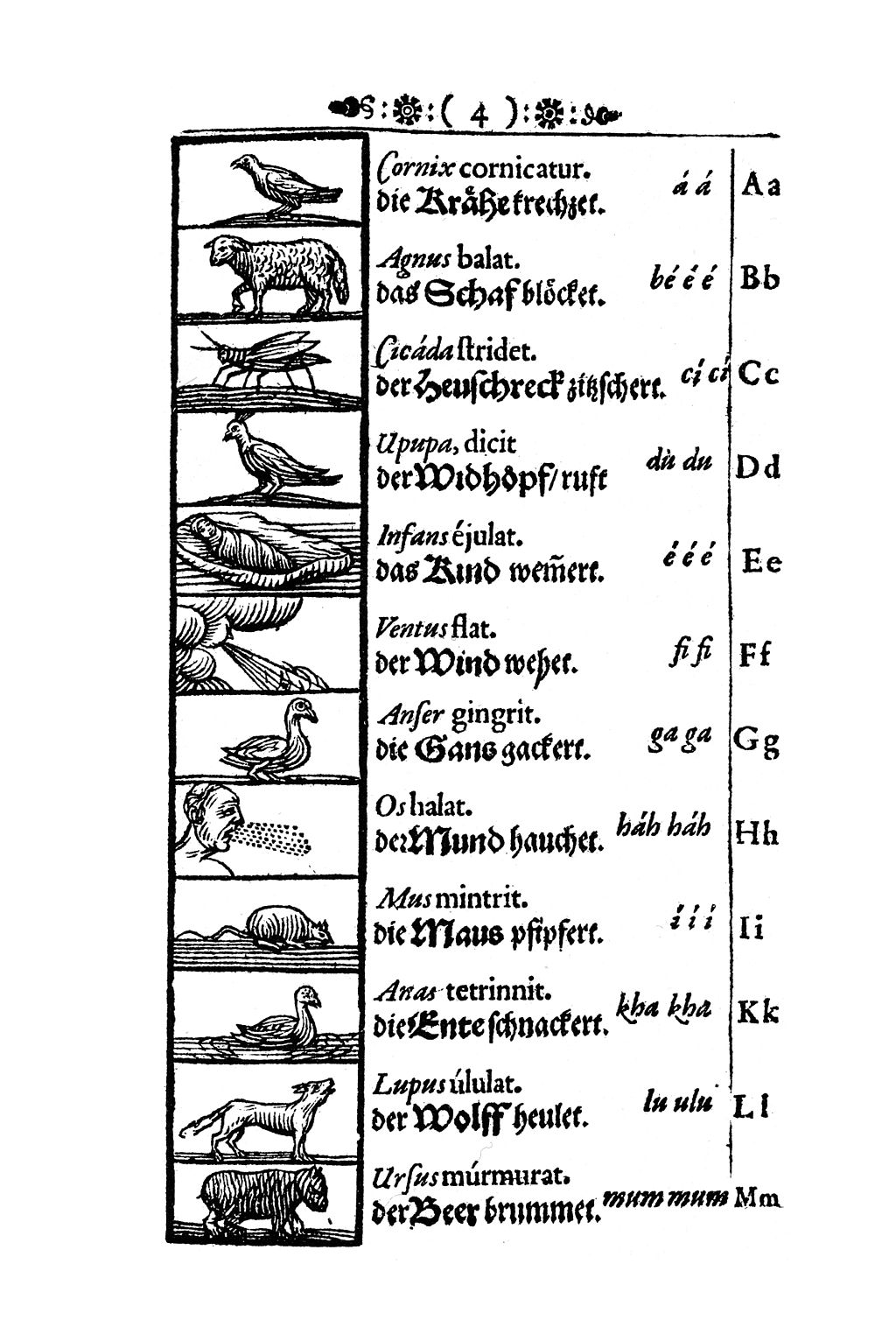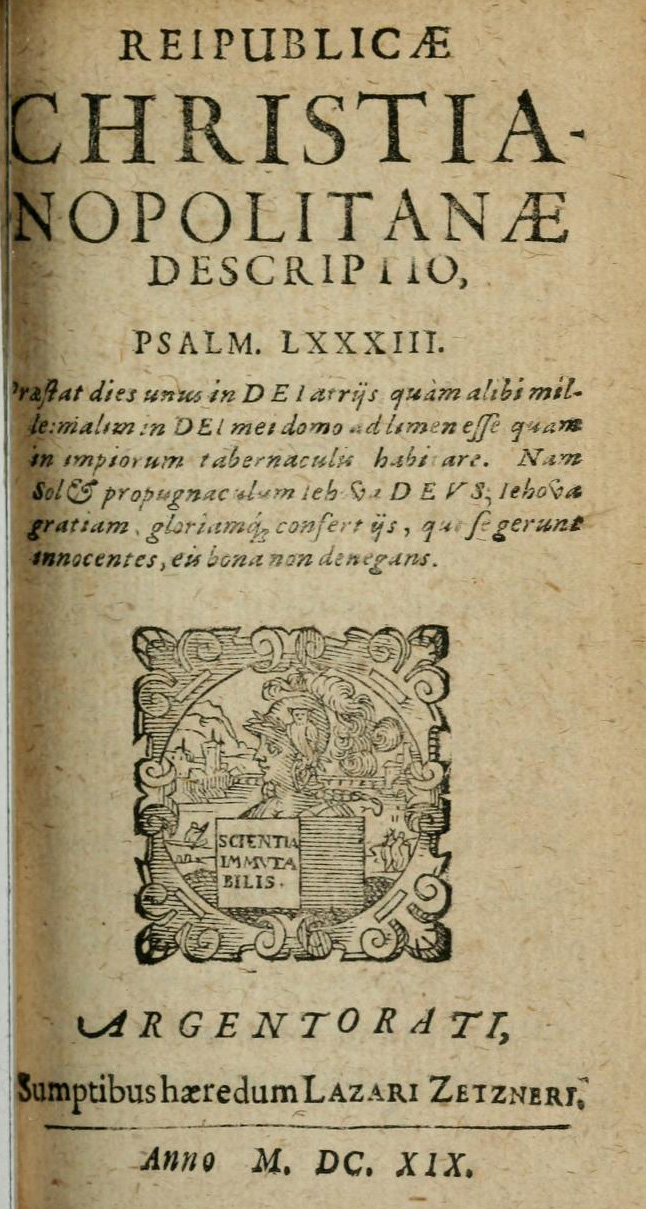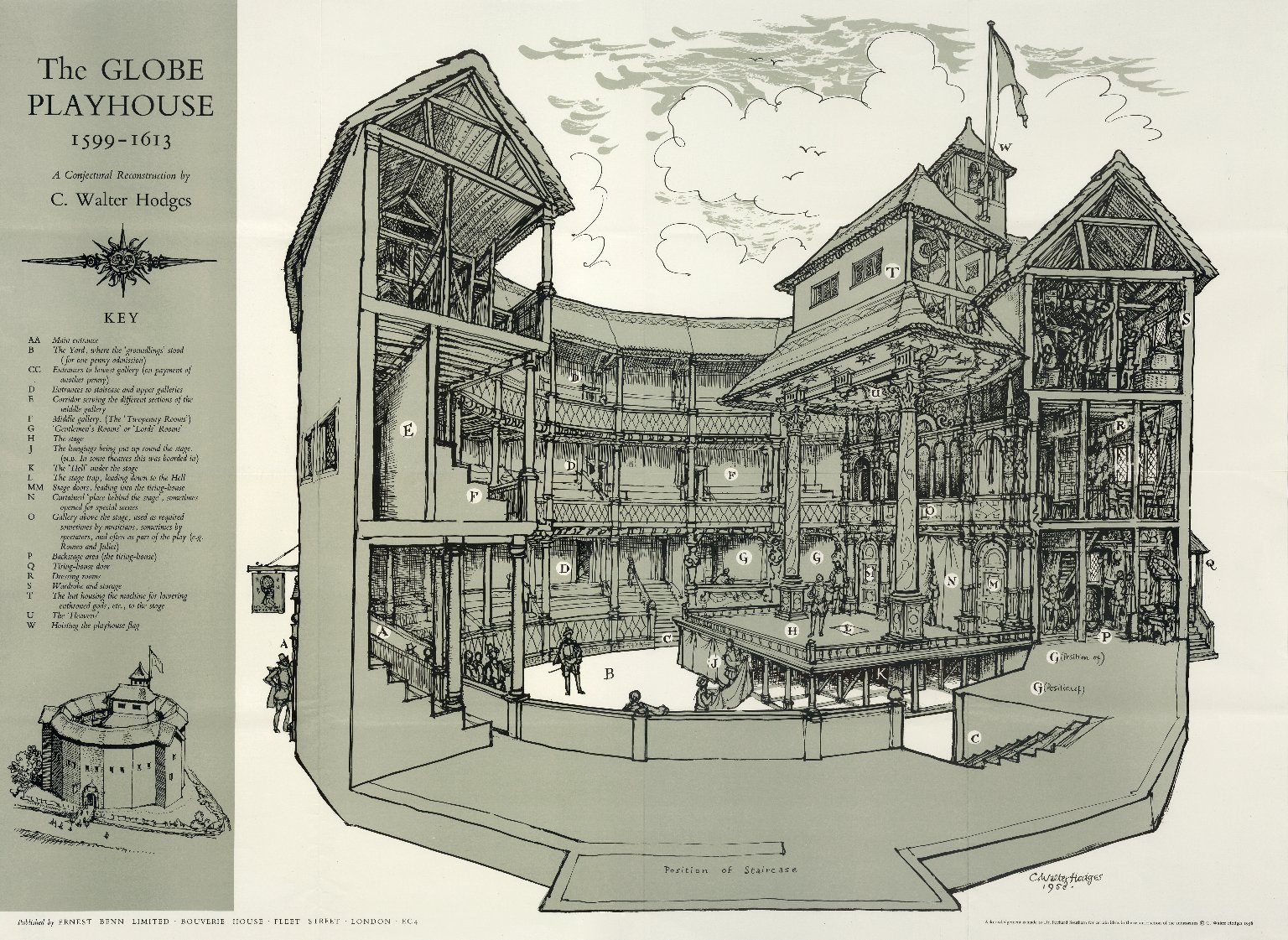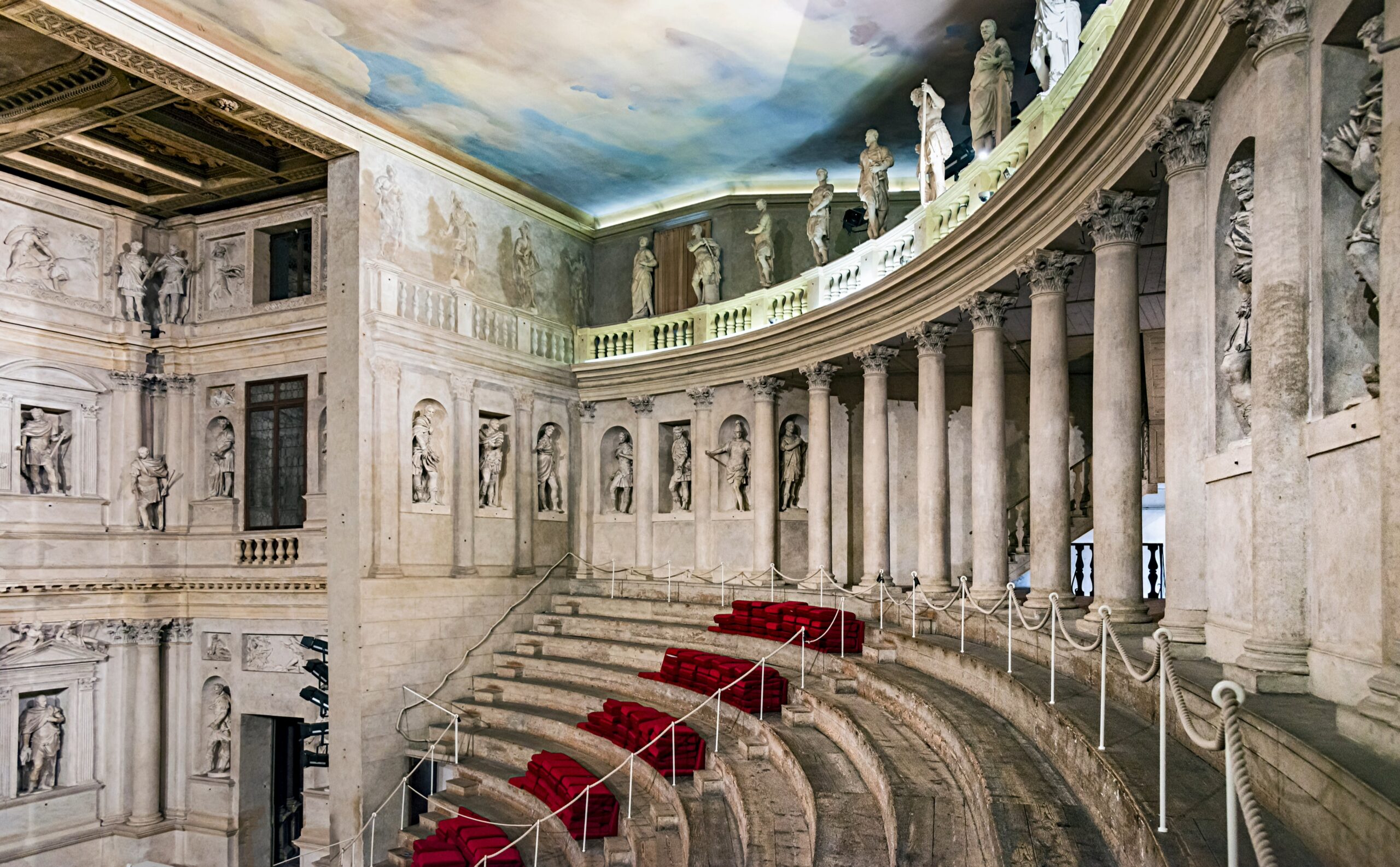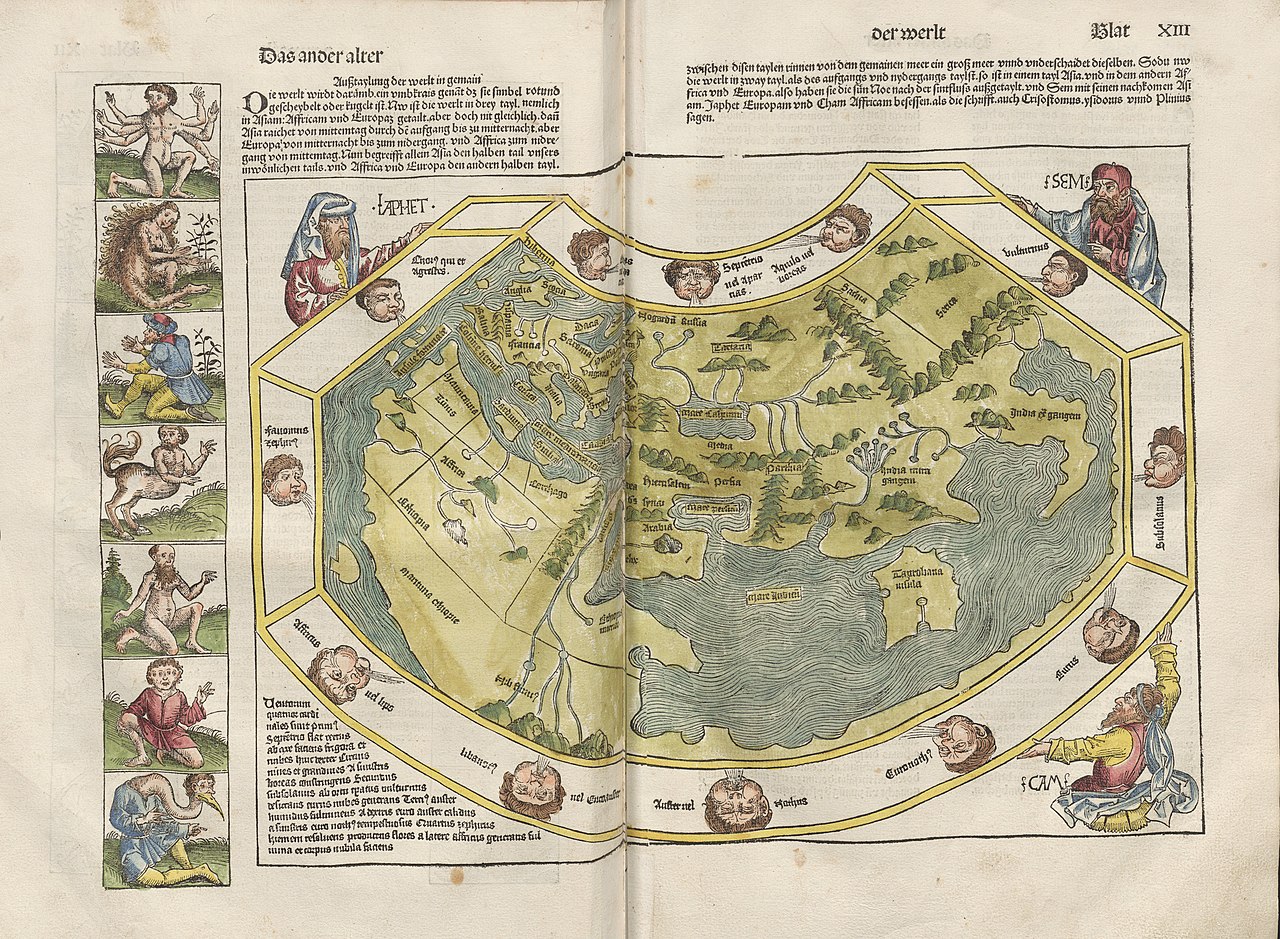Ulrich Füetrers sogenanntes Buch der Abenteuer, ein Auftragswerk im Dienst Herzog Albrechts IV. von Bayern, ist ein monumentales Ensemble von Bearbeitungen prominenter, z.T. aber auch nur peripher gewichtiger Dichtungen aus dem Gattungsbereich der Artus- und Gralsepik, dazu der Trojaerzählung Konrads von Würzburg als historischer Basierung. In 11655 Strophen zu je 7 Versen, also insgesamt 81585 Versen, wird das Sujet von den trojanischen Wurzeln über die Geschichte Parzivals und des Grals nach Wolfram von Eschenbach sowie dem Jüngeren Titurel erzählt; dazu kommen eine Erzählung über den Zauberer Merlin nach Albrecht von Scharfenberg, eine über Gawan, den traditionell prominentesten Artusritter, nach der Crone Heinrichs von dem Türlin und eine Lohengrin-Erzählung. Es folgen die Abenteuer von sieben einzelnen Rittern nach der Vorgabe von Artuserzählungen verschiedener, zum Teil unbekannter Autoren; am prominentesten ist die Geschichte Ibans nach dem Iwein Hartmanns von Aue. Die Schlusssequenz, die an Umfang den aller anderen Teilerzählungen zusammen übertrifft, bearbeitet den Prosa-Lancelot, ein bedeutendes Werk der nachklassischen Periode. Leitlinie ist die Lebensgeschichte Lannzilets, seine Kindheit, sein Erscheinen am Artushof, seine im Unterschied zur ehebrecherischen Beziehung im Posa-Lancelot dem Konzept des amor purus gemäß dem Liebestraktat des Andreas Capellanus bzw. der deutschen Übertragung durch Johannes Hartlieb verpflichtete Liebesbeziehung zur Königin Ginover, seine diversen Abenteuer. Die Handlung mündet in den eben wegen der fälschlich als Ehebruch inkriminierten Liebe ausbrechenden Krieg mit Artus, aus dem die Vernichtung des Artusreichs, der Tod des Königs und die Weltentsagung des Helden resultieren. In diese Erzählfolge ist, dem Prosa-Lancelot entsprechend, die Geschichte Galaads eingebettet, Lannzilets Sohn aus einer durch Täuschung herbeigeführten Vereinigung mit der Tochter des Gralskönigs. Mit Galaad wird ein neuer Gralsheld etabliert, mit dessen Tod der Gral selbst aus der Welt genommen wird.
Dieses chronikalische Gesamtkonzept eröffnet ein in der mittelalterlichen Epik beispiellos weit ausgreifendes Spektrum des Artus- und Gralsujets. Füetrer bemüht sich dabei, Widersprüche zwischen den einzelnen Teilen so weit wie möglich zu vermeiden. So eliminiert er das erfolgreiche Gralsabenteuer Gawans aus der Crone, welches dem Gralsheldentum Parzivals abträglich ist. Gleichwohl lassen sich Kohärenzbrüche zwischen den einzelnen Teilen nicht vermeiden. Insbesondere betrifft dies den Austausch des Gralshelden in der Lannzilet-Partie; nicht mehr Parzival, sondern seinem Sohn Galaad ist die finale Erfüllung des Abenteuers vorbehalten.
Füetrer fasst seine Intention, eine epische Totale zu schaffen, in die Metapher eines Baumes, bestehend aus Wurzel, Stamm, Ästen, Laub und Früchten. Formales Äquivalent dieser integrativen Intention ist das Strophenschema des Jüngeren Titurel als Bearbeitungsgrundlage aller Einzelerzählungen. Darüber hinaus haben die nach gleichem Grundmuster gestalteten Prologe zu den Teilwerken nicht nur gliedernde, sondern auch verklammernde Funktion, ebenso wie die Diskurse mit der Personifikation Frau Minne, in die sich der Erzähler an markanten Stellen verstrickt.
– Rudolf Voß
Literatur / Quellen:
- Voß, Rudolf: „Werkkontinuum und Diskontinuität des Einzelwerks – zum Ensemble von Ulrich Füetrers Buch der Abenteuer“. In: Cyclification. The Development of Narrative Cycles in the Chansons de Geste and the Arthurian Romances, hg. von Bart Besamusca, Willem P. Gerritsen, Corry Hogetoorn, u. a., Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1994, S. 221–227.
- Bastert, Bernd: „Zu Autor und Werk“. In: Ulrich Füetrer. Das Buch der Abenteuer, Teil 2, hg. von Heinz Thoelen, Göppingen: Kümmerle 1997, S. 533–599.