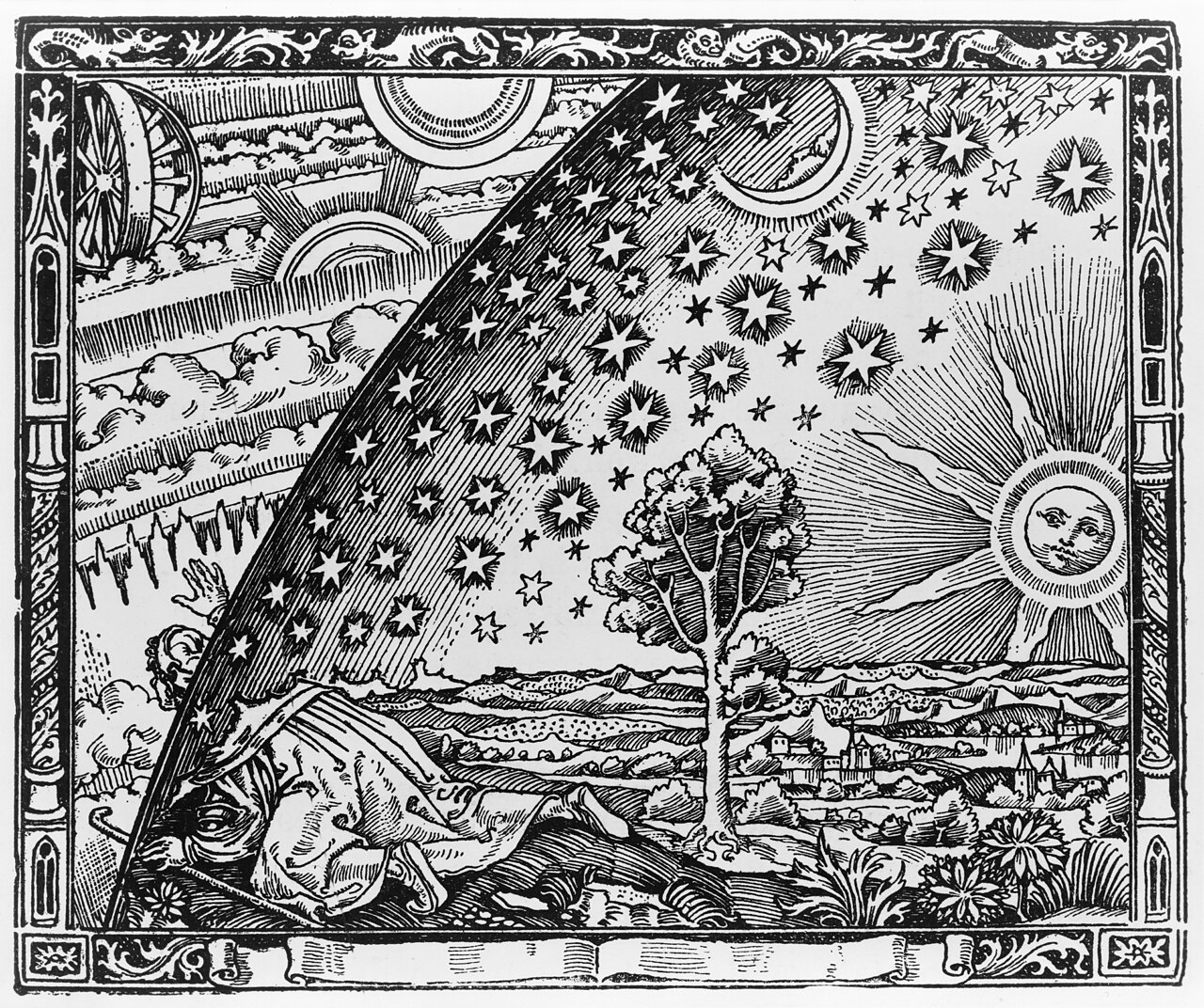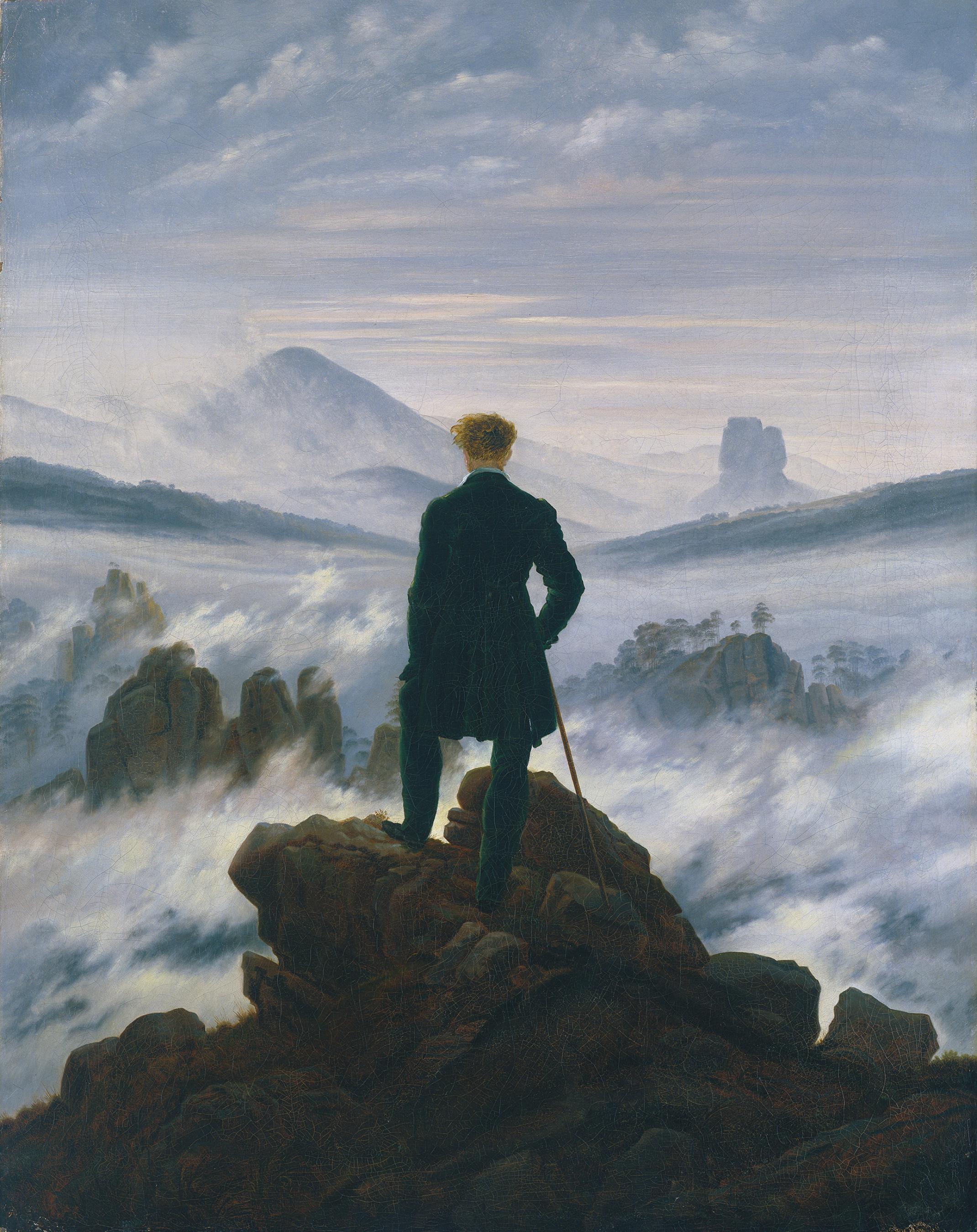Erzählung um die Fiktion einer Bibliothek mit allen auf Basis eines 25-Zeichen-Alphabets kombinatorisch möglichen Büchern. In der so entstehenden Unmasse an größtenteils sinnlosen Zeichenketten verbergen sich indes zwangsläufig auch alle sinnvollen Konstellationen und Inhalte, alle möglichen Gedanken, Geschichten und Wahrheiten, selbst wenn die Chance, zu Lebzeiten auf ein Buch zu stoßen, das etwa ein Shakespeare-Drama enthält, in der Quasi-Unendlichkeit dieses Babylonischen Büchermeeres verschwindend gering ist. Als visionäre Überbietung realer Unternehmungen zur Sammlung ‚aller Bücher‘ wie der Bibliothek von Alexandria rekurriert Borges’ vielrezipierte Idee auf die Tradition der Ars Combinatoria (Raimundus Lullus) und hat in Laßwitz’ Die Universalbibliothek einen nahen Vorläufer. – Johannes Ullmaier
Literatur / Quellen:
- Borges, Jorge Luis: Gesammelte Werke in zwölf Bänden. Band 5: Der Erzählungen erster Teil: Universalgeschichte der Niedertracht / Fiktionen / Das Aleph, München: Hanser 2000, S. 151–160
- Eco, Umberto: Die unendliche Liste, München: Hanser 2009, S. 363–370
- Lullus, Raimundus: Ars brevis [1308], Hamburg: Meiner 2001