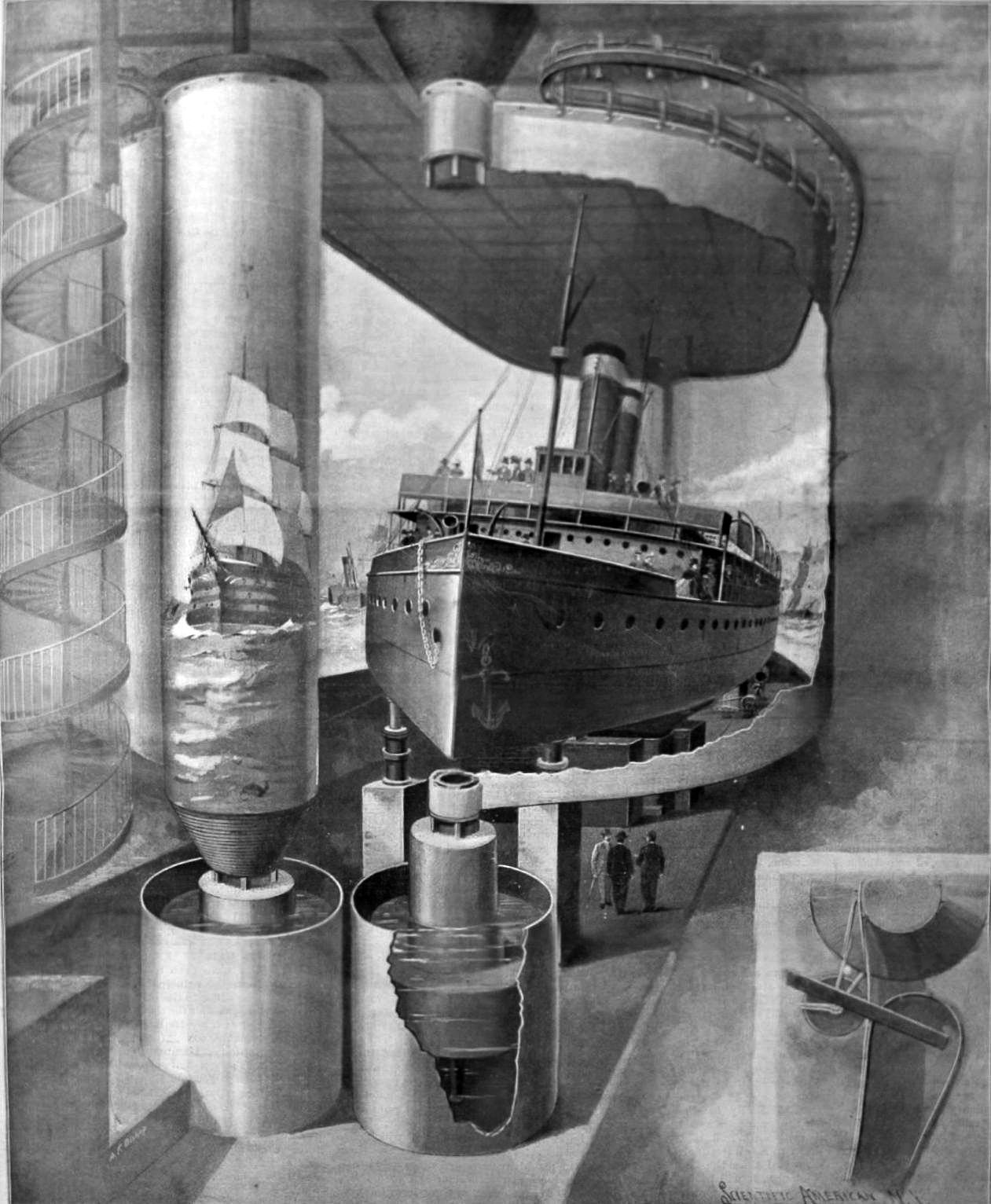Im Jahr 1920 verfasst und infolge der rigorosen sowjetischen Zensur erst 1924 und nur im Tamizdat publiziert, schildert der dystopische Roman des russischen Schriftstellers Jewgenij Iwanowitsch Samjatin (1884–1937) ein aus technischem Fortschritt und damit einhergehendem Machbarkeitswahn resultierendes Gesellschaftssystem des entindividualisierenden Totalitarismus. Von der Außenwelt durch eine Mauer getrennt, führen die Bewohner ein in allen, auch privaten, Belangen minutiös reglementiertes Leben als Nummern und in einheitlichen Uniformen. Sie leben in kubischen Wohnblöcken aus Glas, deren Transparenz sie allseits diszipliniert. Samjatins extrapolierende Überzeichnung der zeitgenössischen Sowjetdiktatur nimmt in der Diegese auch deren Zusammenbruch vorweg, wodurch sie zugleich zur allgemeinen Allegorie auf die panoptische Hybris des Menschen wird. Samjatins Werk inspiriert in der Folge maßgeblich heute bekanntere Dystopien wie Aldous Huxleys Brave New World (1932) und George Orwells 1984 (1949). – Violetta Xynopoulou
Literatur / Quellen:
- Leucht, Robert: Dynamiken politischer Imagination. Die deutschsprachige Utopie von Stifter bis Döblin in ihren internationalen Kontexten 1848–1930, Berlin/Boston: De Gruyter 2016
- Samjatin, Jewgenij: Wir [1920/24], Köln: Kiepenheuer & Witsch 1958
- Schneider, Manfred: Transparenztraum. Literatur, Politik, Medien und das Unmögliche, Berlin: Matthes & Seitz 2013, S. 253–256