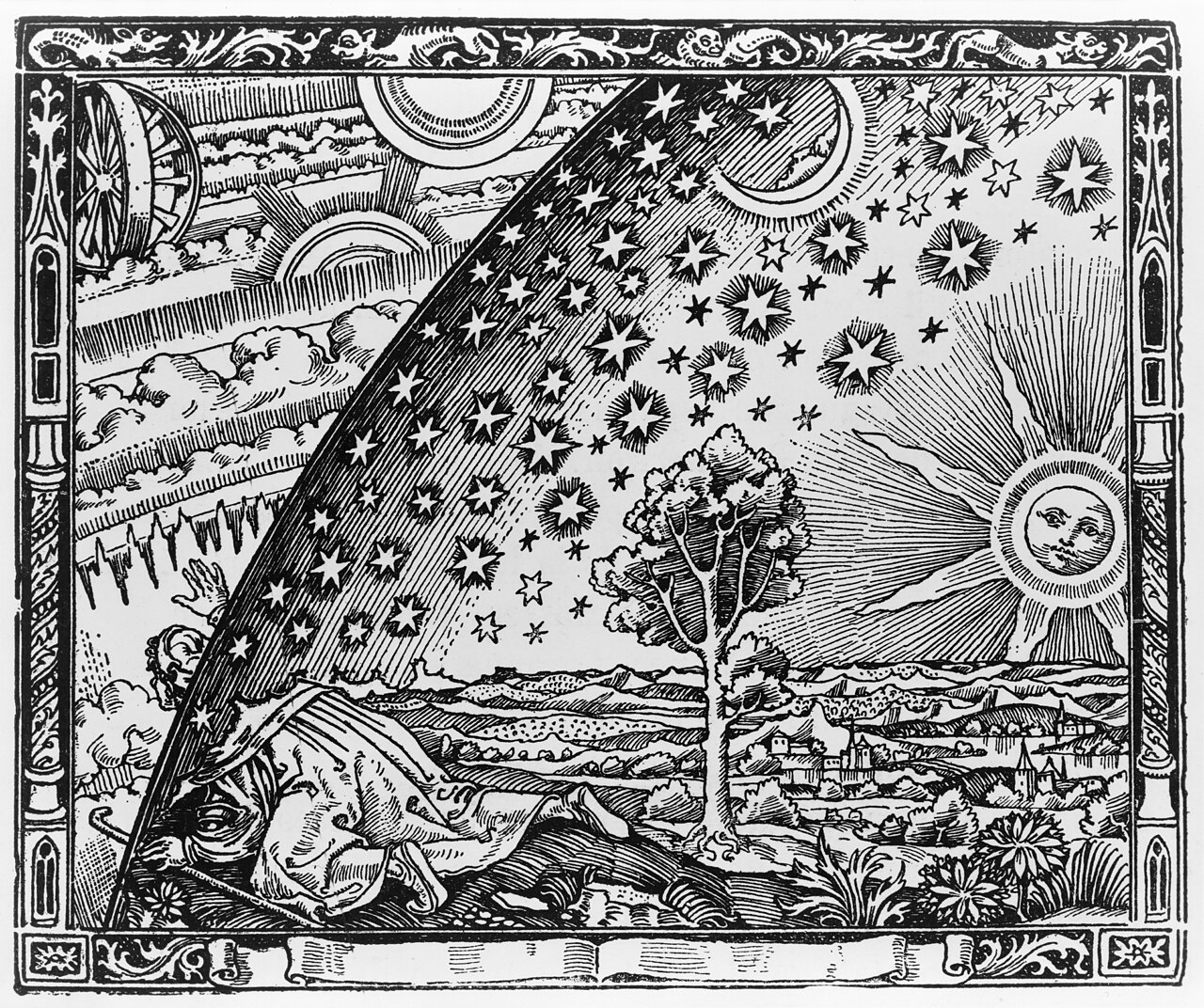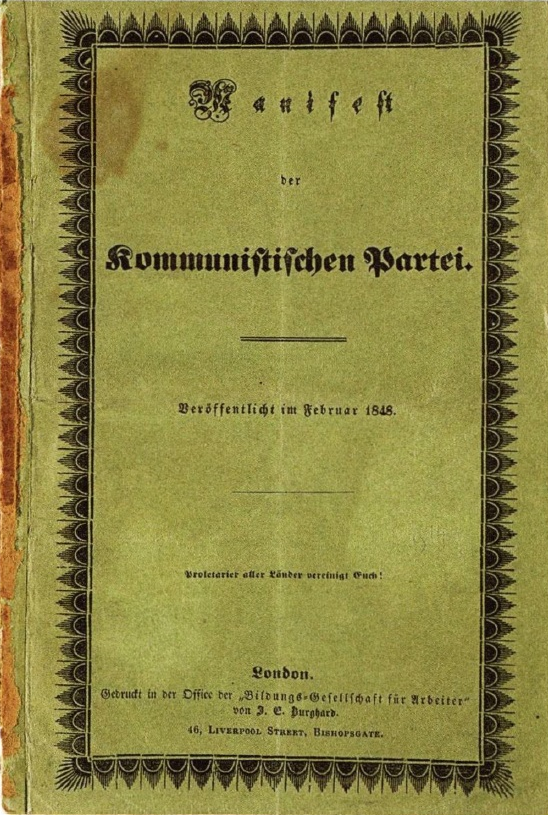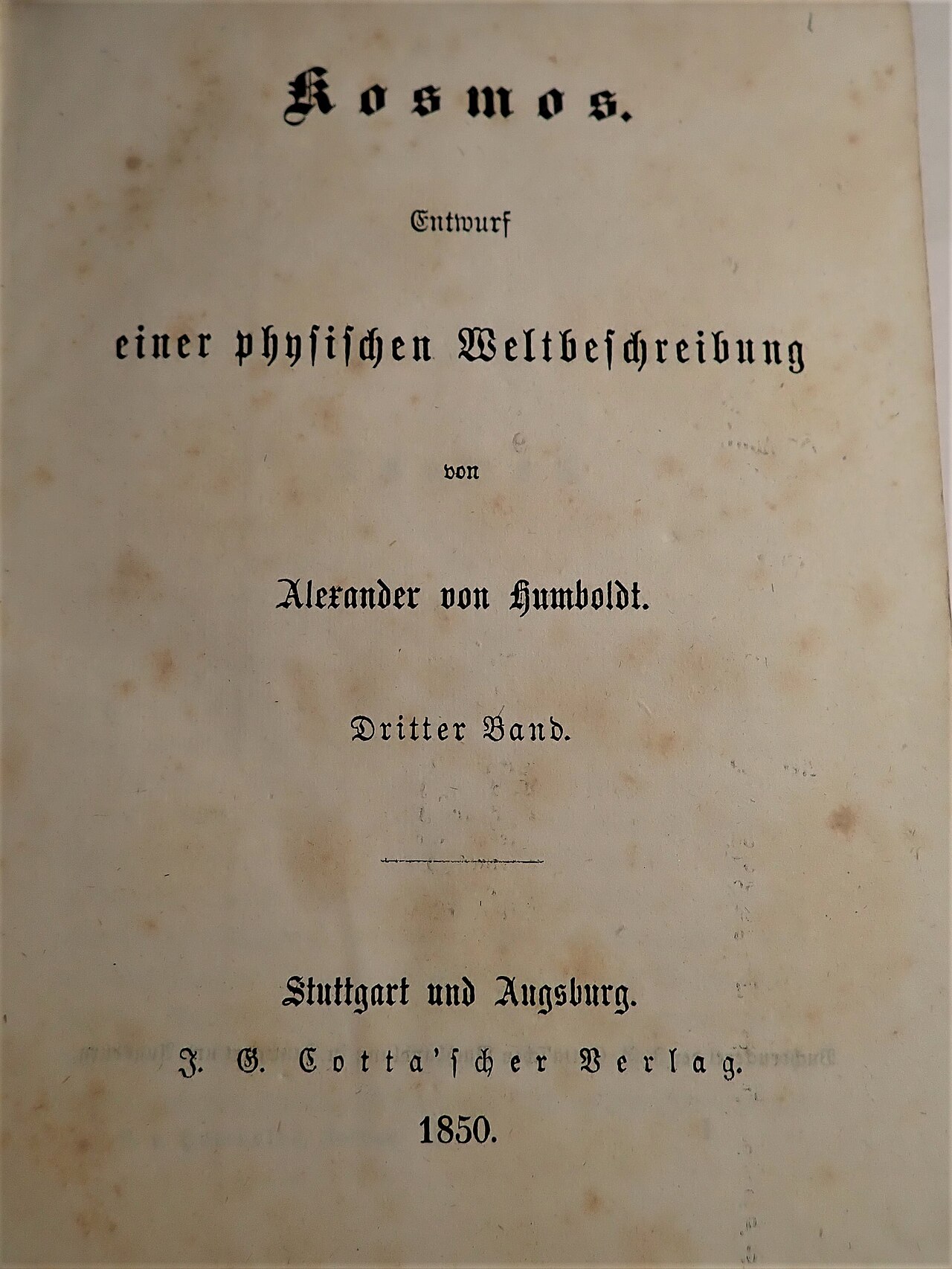Im Vorwort zu seinem Essai philosophique sur les probabilités entwirft das Mathematik/Statistik- und Physik-Genie Pierre-Simon Laplace (1749–1827) eine deterministisch-physikalistische und kalkül-basierte Neuversion des panoramatischen Allschau- und Allwissenheitsbegehrens: „Wir müssen also den gegenwärtigen Zustand des Universums als die Wirkung seines früheren Zustands und als die Ursache des künftigen Zustands betrachten. Eine Intelligenz, die zu einem bestimmten Zeitpunkt alle Kräfte, von denen die Natur beseelt ist, und die jeweilige Situation der Wesenheiten, aus denen sie sich zusammensetzt, kennen würde, wäre, wenn sie zudem noch groß genug wäre, um diese Daten einer Analyse zu unterziehen, in der Lage, die Bewegungen der größten Körper des Universums bis hinunter zu denen des leichtesten Atoms in derselben Formel zu erfassen. Nichts wäre für sie ungewiss. Zukunft wie Vergangenheit lägen ihr klar vor Augen.“ Die hier inaugurierte Beobachtungsinstanz ist seither als „Laplacescher Dämon“ sprichwörtlich geworden. Indes wird die Möglichkeit solcher Allregistratur (von der auch Laplace real nicht überzeugt war) in der Folge mehrfach grundlegend bestritten: die Option einer gleichzeitigen Weltzustandserfassung durch die Relativitätstheorie, der physikalische Determinismus durch die Kopenhagener Deutung der Quantentheorie und die vollständige Berechenbarkeit per se aufgrund real-ontischer und kalkül-logischer Limitationen. Durch Errungenschaften wie die Schrödinger-Gleichung, die universale Turing-Maschine oder den Quantencomputer periodisch neu befeuert, bleibt das Konzept als approximativ erstrebte Teleologie dennoch lebendig, am prominentesten in den universalen Visionen einer Theory of Everything. – Johannes Ullmaier
Weblinks:
🖙 Zitatstelle im Original
🖙 Wikipedia