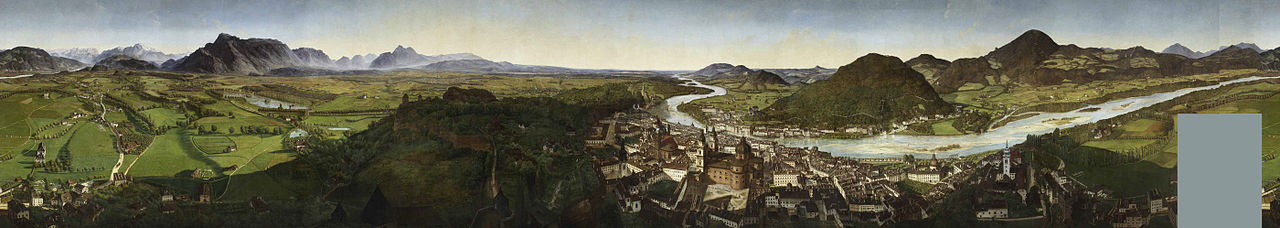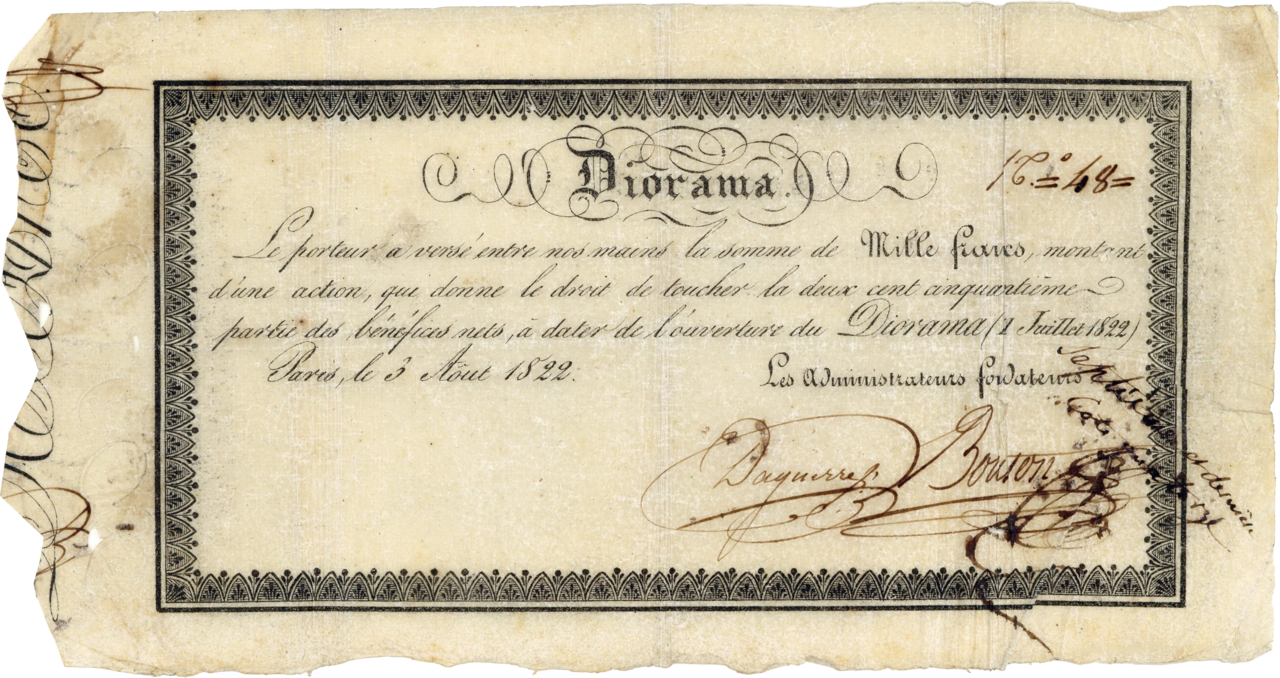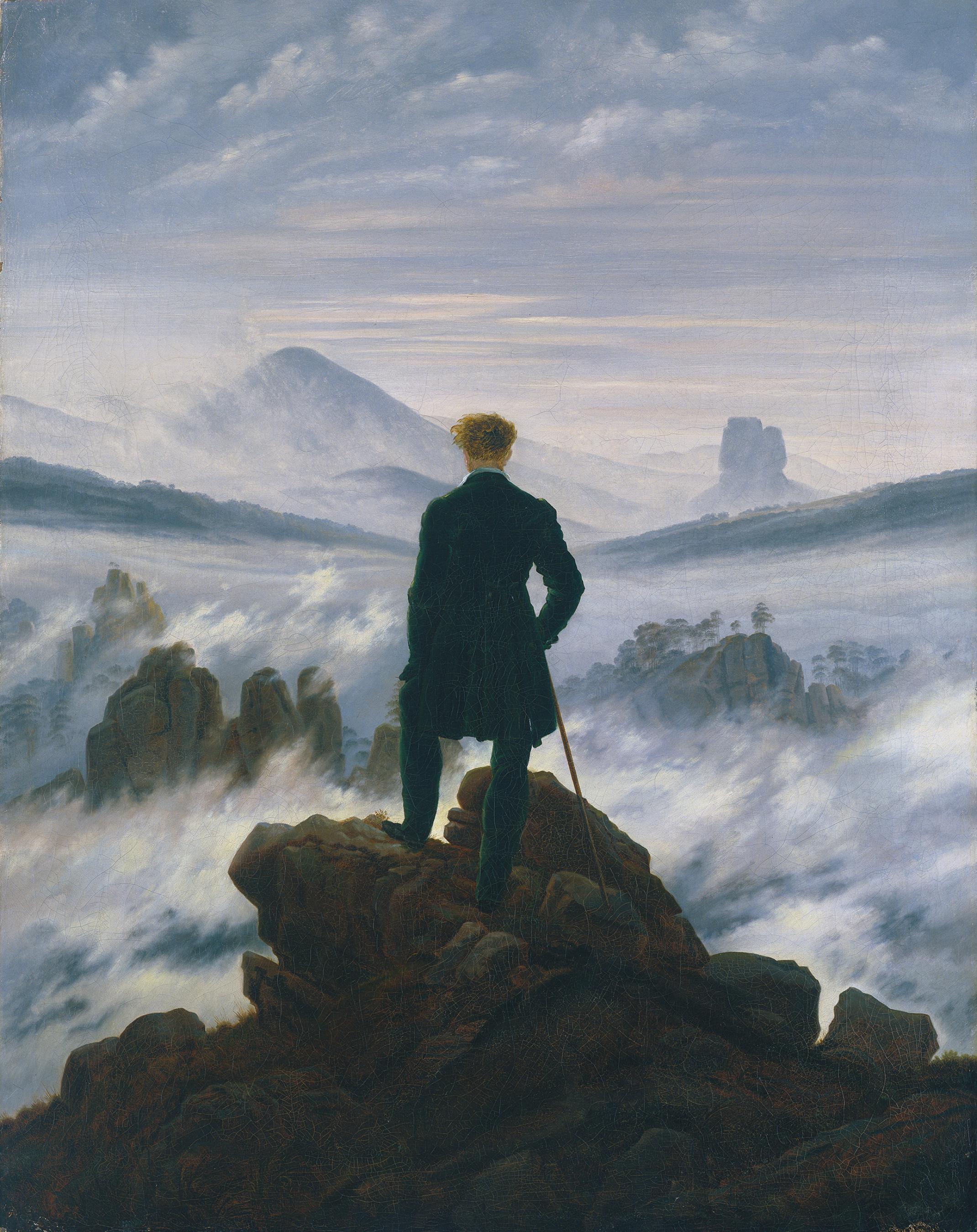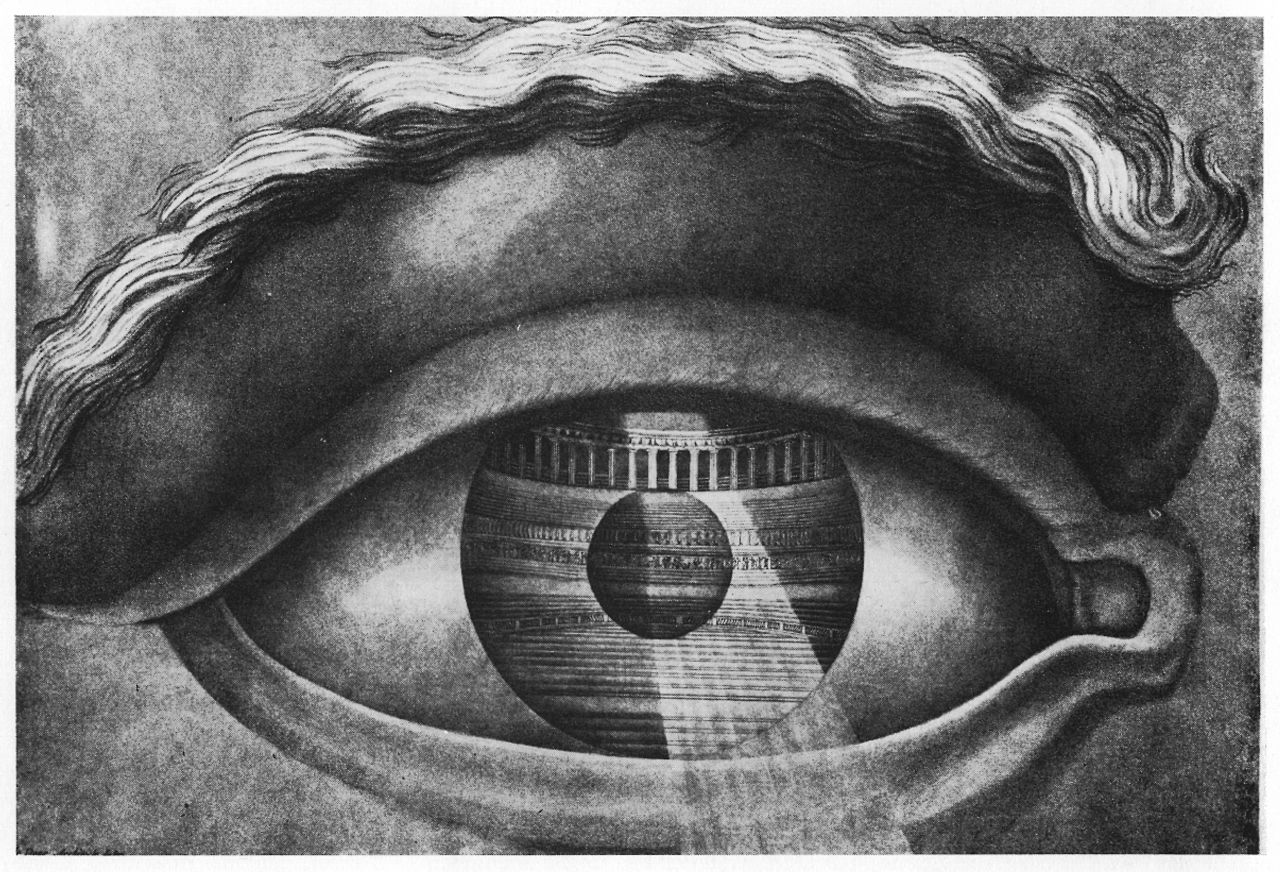Den Grundstein für sein Konzept von „Weltliteratur“ legt Goethe bereits im Jahr 1801 in der Notiz, dass eine bloß patriotische Kunst oder Wissenschaft nicht existiere, sondern beide nur im Kontext einer allgemeinen und freien Wechselwirkung blühen könnten (Goethe, Ästhetische Schriften 1771–1805, S. 809). Den zukunftsträchtigen (und von Wielands vorangehendem Gebrauch des Wortes abweichenden) Begriff von „Weltliteratur“ prägt Goethe jedoch erst im Jahr 1827 in einem Gespräch mit Eckermann (Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe, S. 225), in dem er die Nationalliteraturen verabschiedet und eine neue Epoche inauguriert, die sich durch einen weltweiten literarischen Austauschprozess kennzeichne und keiner nationalen Begrenzung unterliege. Damit bleibt die weltliterarische Dynamik nach Goethe nicht auf die bloße Kenntnis- und Bezugnahme von Autor:innen untereinander beschränkt, sondern konstituiert sich durch einen Gemeinsinn, der auf einem geteilten Wissens- und Wertefundus beruhen und sich im Zuge der verbesserten Kommunikations- und Transportmöglichkeiten verfestigen werde. Wenngleich de facto noch stark eurozentrisch, begründet Goethe so die Auffassung von Literatur als einem gesamtmenschheitlichen Phänomen, das aus universalem, sprich hier: internationalem wie supraepochalem Geist heraus evolviert. – Nina Cullmann
Literatur / Quellen:
- Strich, Fritz: Goethe und die Weltliteratur, Bern: Francke 1946
- Goethe, Johann Wolfgang: Ästhetische Schriften 1771–1805. Sämtliche Werke. Bd. 18, Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag 1998
- Goethe, Johann Wolfgang: Johann Peter Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. Sämtliche Werke. Bd. 39., Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag 1999