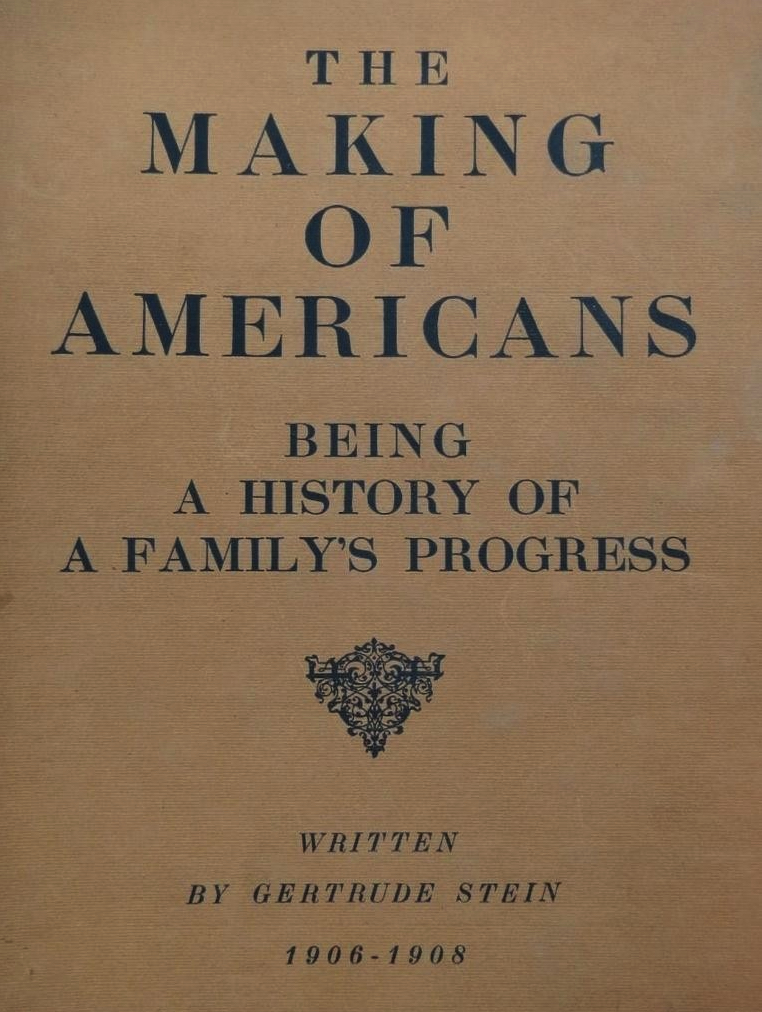Das fragmentarisch überlieferte und postum im Rahmen einer editionsphilologischen Sichtung Rolf Tiedemanns als Passagenwerk titulierte Projekt, an dem Benjamin von 1927 bis 1940 arbeitet, begreift sich in seiner offenen, unvollendeten und letztlich wohl unvollendbaren Form als philosophische Geschichtsrekonstruktion der Pariser Urbanität des 19. Jahrhunderts. Diese versucht es in Form eines gigantischen Diskurs-Wimmelbildes in ihrer Gesamtheit zu erfassen und zu präsentieren – in der Hoffnung, aus der Urgeschichte des modernen Kapitalismus das katastrophische 20. Jahrhundert zu erhellen. Anstelle eines stringenten Textkorpus kompiliert Benjamin eine heterogene Materialsammlung, die in 48 Konvoluten, begleitet von zwei Exposés, diverse Text- und Bildquellen sowie Zitate und Kommentare ausbreitet. Bereits das erste Exposé – das einen Einblick in das Themenspektrum gewährt, welches sich von den Pariser Passagen über die Panoramen und Weltausstellungen bis zum Interieur und den Straßen von Paris erstreckt – postuliert, dass Text- und Stadtraum als konvergierende Konzepte zu betrachten seien. So soll die dispositorische Nachahmung der Pariser Passagenarchitektonik, die zum Flanierdurchgang durch die Konvolute respektive Auslagen und Präsentationsräume einlädt, einen gleichermaßen multiperspektivischen wie integralen Zugang zur Dialektik des 19. Jahrhunderts eröffnen. Inwieweit Benjamins panoramatische Utopie einer translinearen Textverräumlichung zur Erfassung einer historischen Totalität sich in der realen Leserezeption vermittelt, muss individuell erkundet werden. – Violetta Xynopoulou
Literatur / Quellen:
- Benjamin, Walter: Das Passagen-Werk, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1983
- Lindner, Burkhardt: Benjamin-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart: J. B. Metzler 2011
- Kranz, Isabel: Raumgewordene Vergangenheit. Walter Benjamins Poetologie der Geschichte, München: Wilhelm Fink 2011