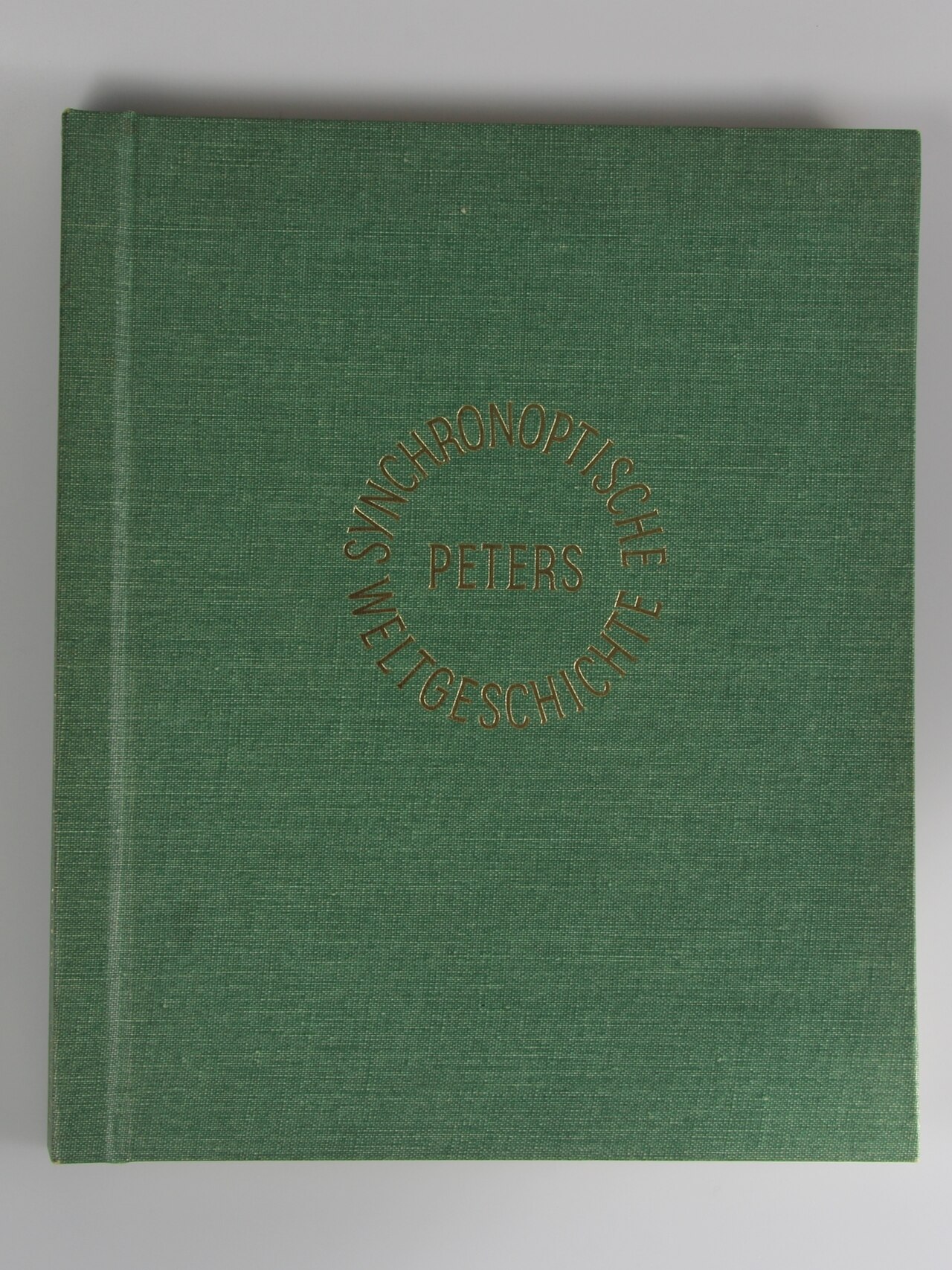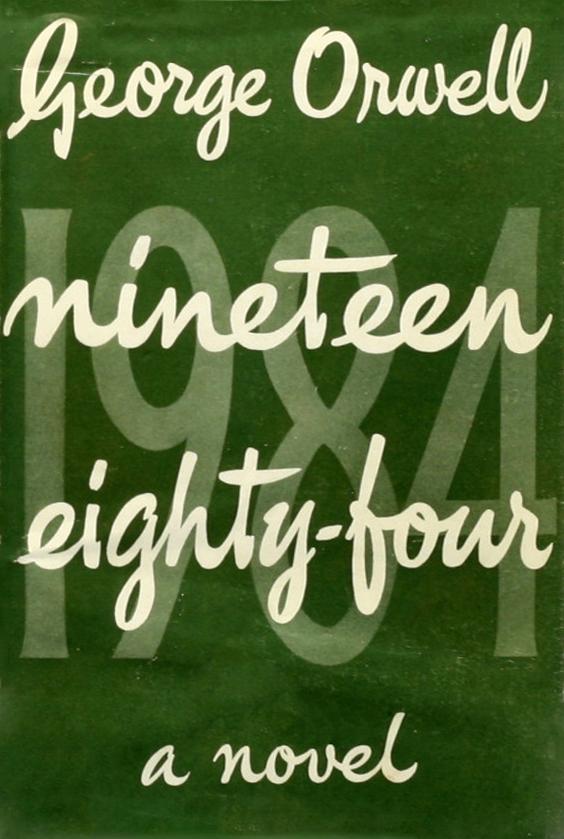Zylindrisches 360°-Multikamera- und -Multiprojektoren-Filmsystem. Es steht in der Tradition von Raoul Grimoin-Sansons Cinéorama und wird unter der Leitung von Roger Broggie und Ub Iwerks für Walt Disney entwickelt. Im damals neu errichteten Freizeitpark Disneyland in Anaheim kommt es mit dem Film A Tour of the West (USA 1955, R: P. Ellenshaw) erstmalig zur öffentlichen Vorführung. Der zwölfminütige Farbfilm zeigt eine Autofahrt durch Städte und Landschaften des Westens der USA. Gefilmt wird im Circarama-Verfahren mit elf 16 mm-Kameras, die kreisförmig auf einer Platte positioniert werden und synchron gestartet werden können. Die gleichnamige Vorführstätte ist ein Rundbau mit 12 m Durchmesser, an der Innenwand ausgestattet mit einer 3 m hohen Leinwand samt Öffnungen und Trennbalken. Darin befinden sich elf Projektoren und projizieren das Bild auf die jeweils gegenüber montierten Leinwände. Der Ton wird auf vier Magnetspuren aufgenommen, sodass vier im Raum verteilte Lautsprecher Toneffekte aus verschiedenen Richtungen abspielen. Das Circarama-System wird in den darauffolgenden Jahren auch in Europa auf mehreren Ausstellungen vorgeführt und schrittweise weiterentwickelt: Das System Circle Vision 360 kann ab 1964 durch eine kompaktere Kameraeinheit aus neun 35 mm-Kameras und einem Spiegelsystem eine höhere Bildqualität erreichen. – Kaim Bozkurt
Literatur / Quellen:
- Piccolin, Lucas: „Rundumkinos. Vom Panorama zu 360°-Filmsystemen.“. In: Medienwissenschaft / Hamburg: Berichte und Papiere 78 (2007)
- Nilsen, Sarah: Projecting America, 1958. Film and Cultural Diplomacy at the Brussels World’s Fair, Jefferson, North Carolina/London: MacFarland and Company 2011, S. 60–80
Weblinks:
🖙 Mediarep: Rundumkinos. Vom Panorama zu 360°-Filmsystemen.
🖙 Wikipedia Circle-Vision 360°