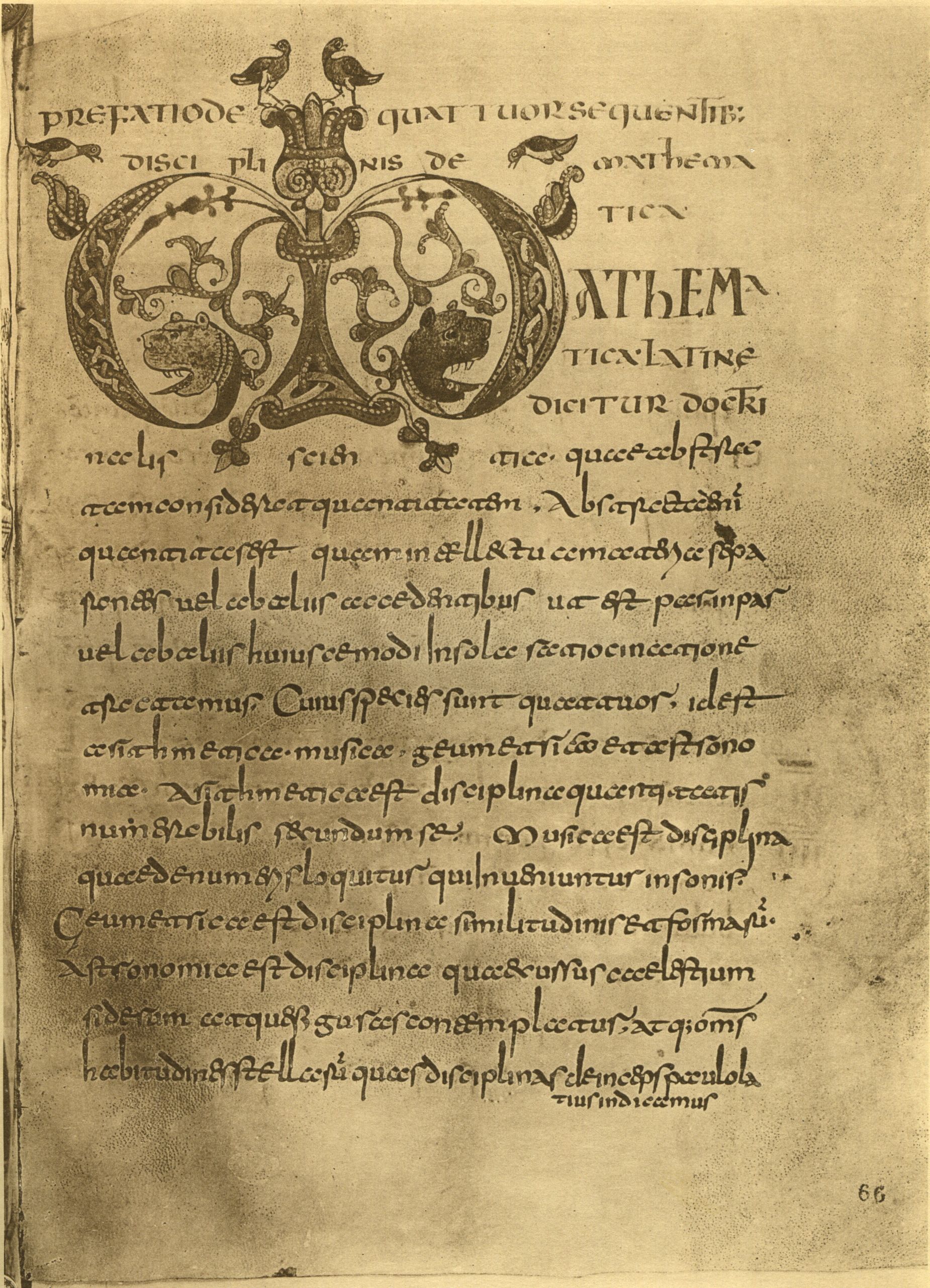Obschon weder genau zu datieren noch überhaupt zu belegen, ist die Ersteigung des ca. 1900 m hohen provenzalischen Bergs durch den italienischen Dichter und Gelehrten, von der er in einem auf den 26. April 1336 datierten, doch erst Jahrzehnte später veröffentlichten Brief an seinen Gelehrtenfreund Francesco Dionigi berichtet, vielfach als Beginn der Renaissance, der Neuzeit, des ästhetischen Blicks oder der Individualität interpretiert worden. Über seinen ersten Gipfeleindruck schreibt er: „Zuerst stand ich, durch den ungewohnten Hauch der Luft und die ganz freie Rundsicht bewegt, einem Betäubten gleich da. Ich schaute zurück nach unten.“ (Petrarca, Die Besteigung des Mont Ventoux [1336], S. 17). Statt ausgiebiger Naturbeschreibungen folgen indes Vergleichsassoziationen zu ihm aus antiken Texten geläufigen Bergen, dann ein sehnsuchtsvoller Blick in Richtung seiner italienischen Heimat sowie ein längerer Rückblick auf das eigene Leben. Nach einer kurzen Beschreibung der umliegenden Geografie (vgl. Petrarca, Die Besteigung des Mont Ventoux [1336], S. 23) beginnt er auf dem Gipfel Augustinus zu lesen, wo er unversehens auf eine Stelle trifft, die vor dem Selbstverlust durch die Bewunderung der „Höhen der Berge“, des „Ozeans Umlauf[s]“ oder der „Kreisbahnen der Gestirne“ warnt. Ähnlich wie bei der Gipfelbesteigung von König Philipp, aus deren Schilderung bei Livius Petrarca anfangs das „ungestüme Verlangen“ (Petrarca, Die Besteigung des Mont Ventoux [1336], S. 7) zu seinem Aufstieg bezieht, bleiben sowohl die Faktenlage wie der panoramatische Ertrag geheimnisvoll im Nebel. – Johannes Ullmaier
Literatur / Quellen:
- Petrarca, Francesco: Die Besteigung des Mont Ventoux [1336], Stuttgart: Reclam 1995
- Wurm, Christoph: „Bergtour mit Augustinus. Petrarca auf dem Mont Ventoux“. In: Forum Classicum. Zeitschrift für die Fächer Latein und Griechisch an Schulen und Universitären 4 (2019), S. 252–257