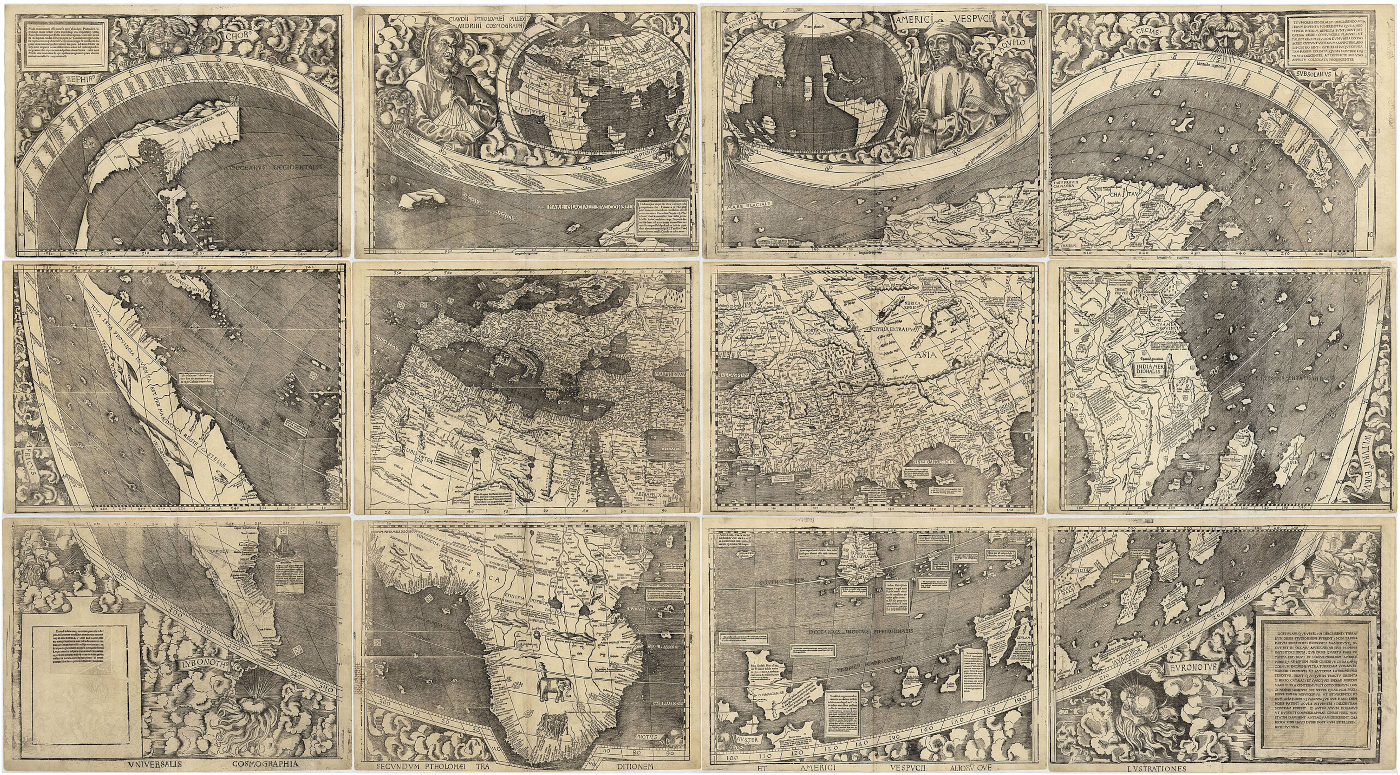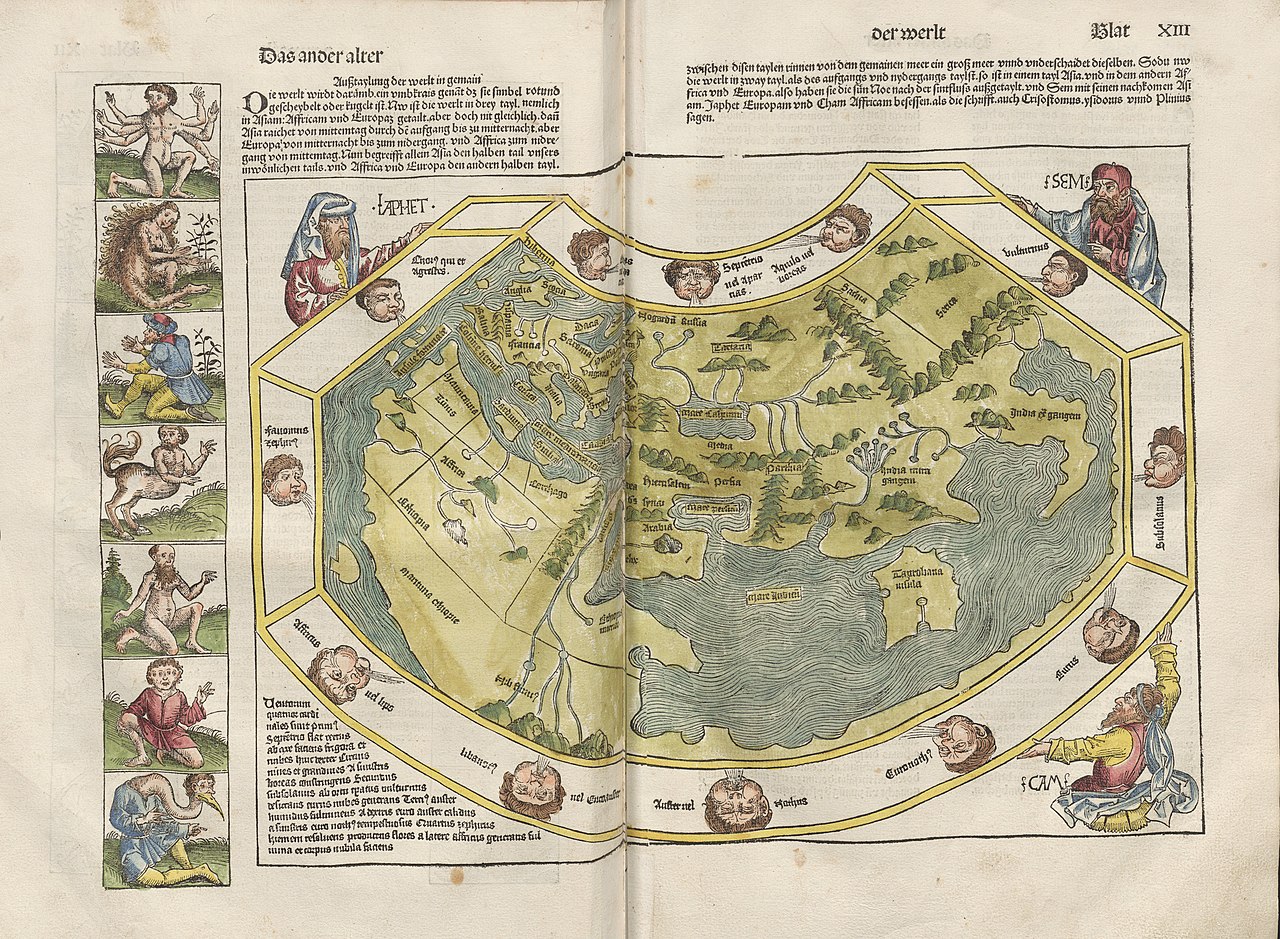Der Autor, wahrscheinlich adliger Jurist am Konstanzer Bischofshof, legt die Intention des Werks im Prolog nach dem Horazischen Motto des prodesse und delectare dar. Seine satirische Präsentation der bäuerlichen Sphäre will er freilich nicht sozial verstanden wissen, sondern im Hinblick auf ethisches Fehlverhalten schlechthin. Die komischen Effekte sollen der menschlichen Schwäche Rechnung tragen, seriöse Belehrung, auf die es eigentlich ankomme, schwerlich in reiner Ausprägung goutieren zu können. Damit den Rezipienten die jeweilige Bezugsebene deutlich wird, kündigt der Verfasser an, die seriös gemeinten Partien mit einer roten Farblinie zu kennzeichnen, die komischen mit einer grünen – was in der einzigen erhaltenen Handschrift auch so durchgeführt ist. Den Titel Ring leitet er aus einem doppelten, materiale All-Erfassung mit formaler Geschlossenheit verbindenden Anspruch ab: nämlich den Belangen des Daseins in der Welt (orbis) umfassend gerecht zu werden und dabei zugleich – im Bild eines edelsteinbesetzten Kleinods (anulus) – einen kostbaren Wissensschatz zu vermitteln. Diesbezüglich werden, der Dreigliederung der Handlung folgend, drei Lebenssphären durchmessen: zunächst die höfische Sphäre, sodann die persönliche Sphäre in ihrer religiösen, ethischen, sozialen und physischen Ausprägung als die gewichtigste, sowie schließlich die politische Konfliktsphäre von Gewalt und Krieg.
Die Erzählung entfaltet in 9699 Versen die Geschichte des plumpen bäuerlichen Helden Bertschi Triefnas. Am Anfang steht seine zwar ungeschickte, letztlich aber doch erfolgreiche Werbung um ein ebenso plumpes Bauernmädchen, in deren Zusammenhang ein Turnier veranstaltet wird, welches, den Voraussetzungen entsprechend, grotesk missrät. Das Hochzeitsfest endet in einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit den Gästen aus der Nachbargemeinde, die sich ausweitet zu einem großen Krieg. Auf beiden Seiten werden Verbündete gesucht: die großen Städte der damaligen Welt, andere Gemeinden und Regionen, aber auch mythologische Gestalten wie Hexen, Zwerge, Riesen, Personal der Heldenepik. Am Ende steht die Vernichtung von Bertschis sozialer Gemeinschaft. Er selbst rettet sich aus der Katastrophe mit einer radikalen Lebenswende, indem er sich, wie später Grimmelshausens Simplicissimus, als Eremit in den Schwarzwald zurückzieht, wodurch er das ewige Heil gewinnt.
In diesen epischen Rahmen ist eine Fülle von oft weit ausgreifenden didaktischen Sequenzen eingebettet, meist explizit, gelegentlich aber auch indirekt als Umkehrbild der normwidrigen Situation. Bezüglich der höfischen Lebenssphäre werden das traditionelle Ethos, das ästhetische Ideal und die kulturellen Rituale der höfischen Liebe ausgebreitet, ferner die Regeln des ritterlichen Kampfes und speziell des Turniers. Bezüglich der allgemeinen Lebensführung geht es maßgeblich um Wissensinhalte, die von den Grundsätzen des christlichen Glaubens her bestimmt sind: Trinitätsdogma, Erlösungsgedanke, die zehn Gebote, die sieben Sakramente, sieben Todsünden, die Pflichten des Kirchgangs, Beichte, Kommunion, Weisheit und Tugend. Es schließen ausführlichste Ratschläge zur praktischen Lebensführung an. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne weitere Differenzierung seien hinsichtlich der lebenspraktischen Orientierung angeführt: Anzeichen von Schwangerschaft, Für und Wider des Ehestands, richtige Partnerwahl, Arbeit und Vergnügen, Achtsamkeit auf gute Gesundheit, ökonomisches Handeln. Didaktische Aspekte bezüglich der Kriegsführung in der Schlusspartie betreffen vornehmlich die Gesichtspunkte Opportunität, Rechtmäßigkeit, Taktik sowie den Umgang mit Gefangenen.
Höchst signifikant für die Spannweite der Didaxe im Ring ist insbesondere der Umstand, dass in völliger Kontraposition zum Postulat ethisch geleiteten Handelns für den sozial diskreditierenden Fall außerehelicher Defloration detailreich und somit nachvollziehbar eine Praktik des Kaschierens dargelegt wird. Der opportunistische Zweck, den Anschein von Unberührtheit zu simulieren, verschafft in diesem Kontext dem Mittel des Betrugs eine, freilich dubiose, Rechtfertigung. Mit solcher Expansion bis in existenzielle Niederungen konstituiert Wittenwilers Dichtung ein nach spätmittelalterlichen Maßstäben annähernd vollständiges, sogar die Grenze zur Diskrepanz überschreitendes didaktisches Universum – dargeboten als auch formal paradoxer, aber in sich stimmiger ‚Faden-Ring-Gesamtquerschnitt‘ der materialen und moralischen Welt. – Rudolf Voß
Literatur / Quellen:
- Voss, Rudolf: „Weltanschauung und poetische Totalität in Heinrich Wittenwilers Ring“. In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 93 (1971), S. 351–365.