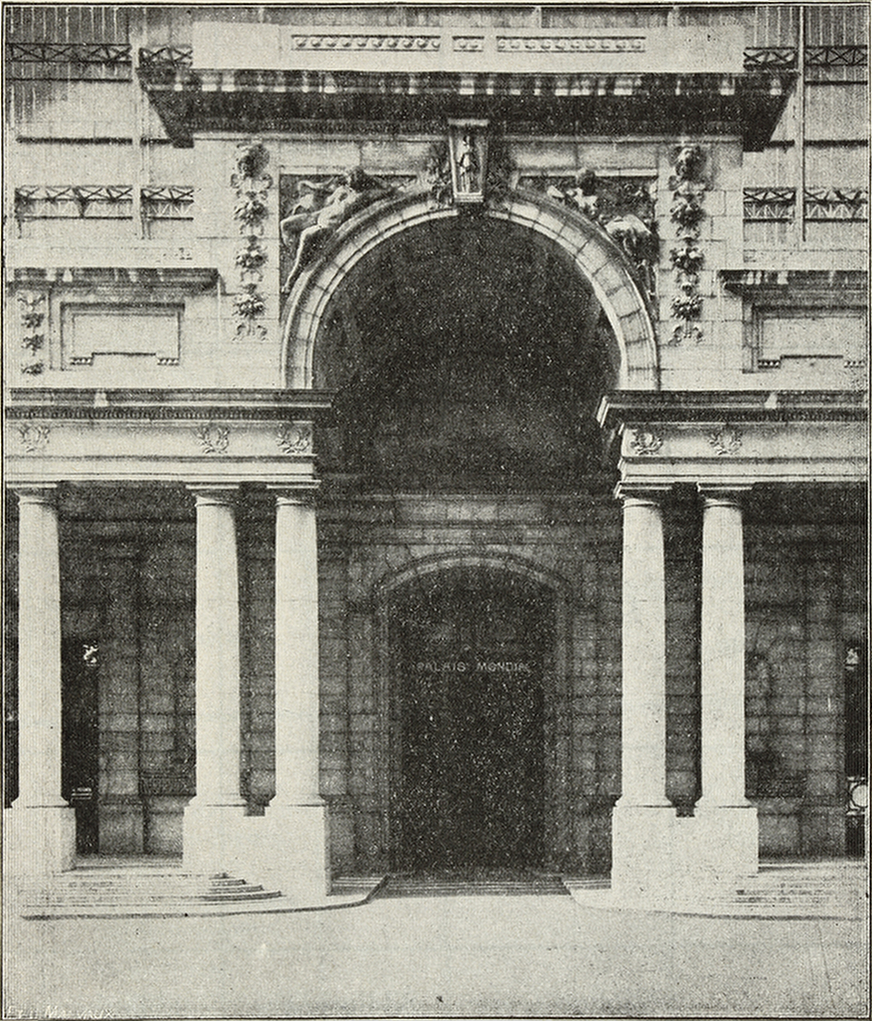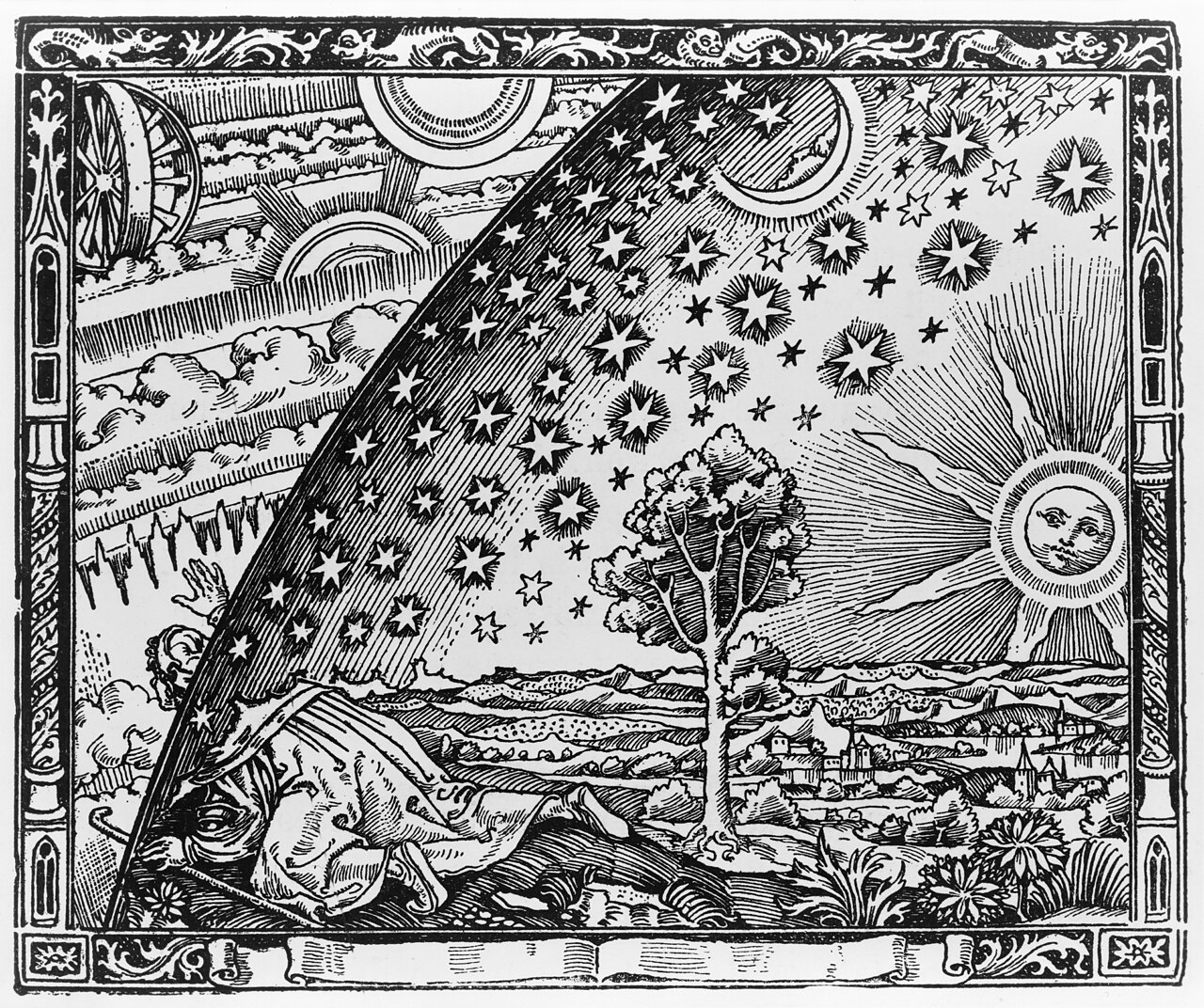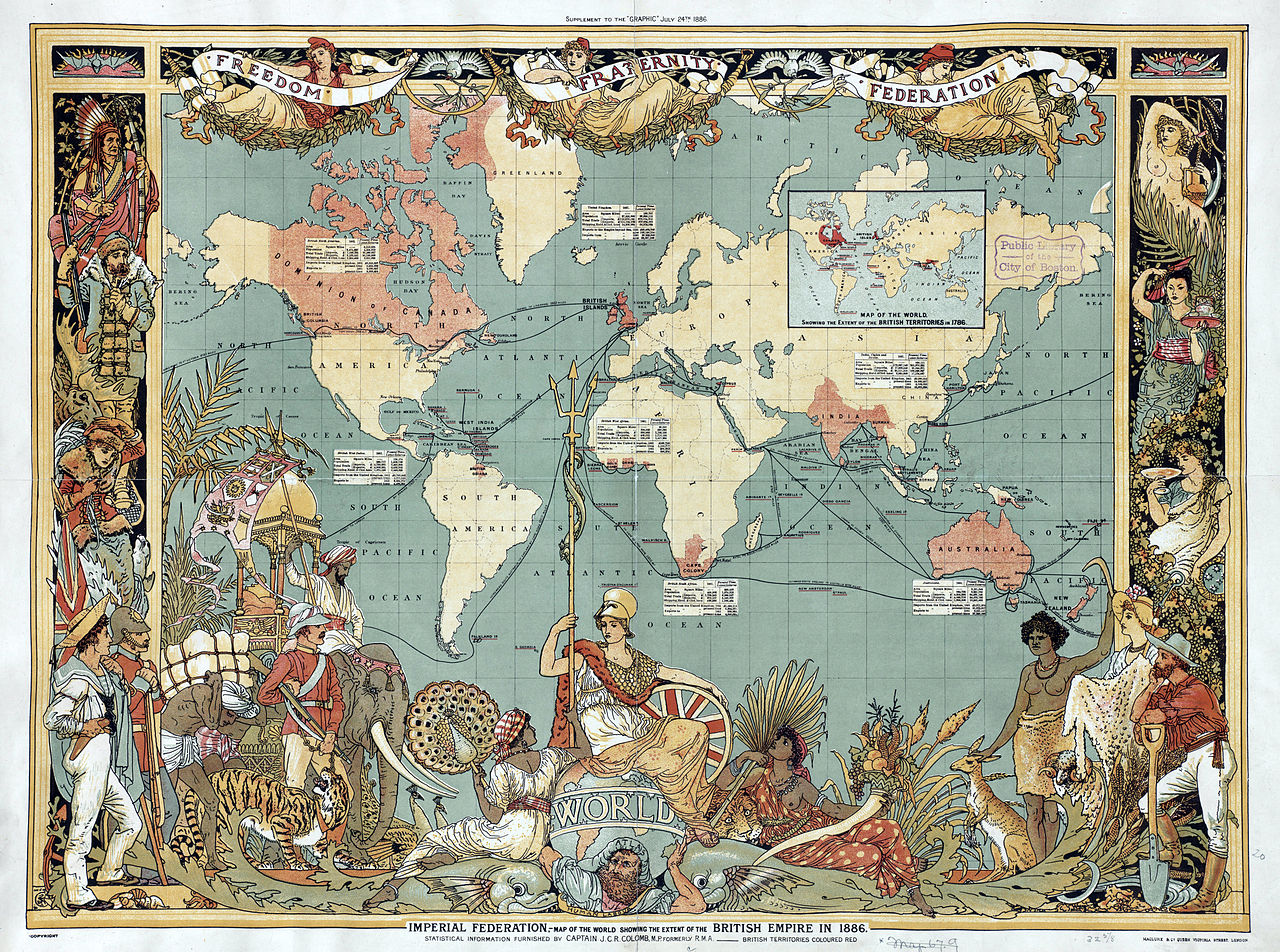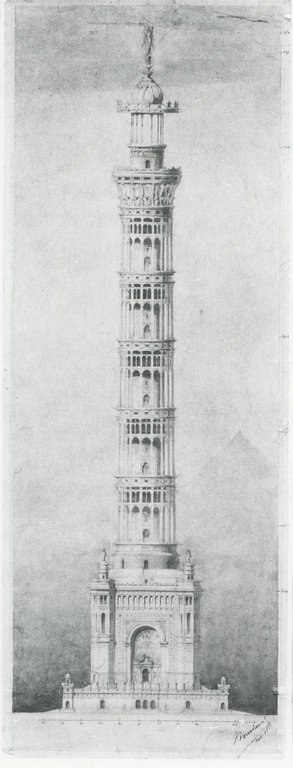1925 auf Betreiben Friedrich Althoffs an der Staatsbibliothek zu Berlin angesiedeltes Projekt zur retrospektiven Erfassung aller im 15. Jahrhundert gefertigten Druckwerke, sogenannter Wiegendrucke bzw. Inkunabeln. Ursprünglich beim Anton Hiersemann Verlag in Leipzig als Print-Edition erschienen, ist der Katalog seit 2009 zusätzlich als Online-Datenbank abrufbar. Seither wird er konsequent aktualisiert und liegt so – stellvertretend für alle kumulativ gepflegten Gesamtverzeichnisunternehmungen – stets zugleich in je aktuell umfassender und doch vorläufiger Gestalt vor. Die 24 Printbände bieten über 50.000 alphabetisch sortierte Einträge, die folgendem Schema folgen: 1) bibliografische Angaben; 2) Auskunft zur Kollation; 3) Beschreibung des Textinhalts mit Übernahme des von Ludwig Hain im Repertorium bibliographicum entworfenen Konzepts der Wiedergabe von Incipit und Explicit; 4) Quellen- und Exemplarnachweise. Programmatisch erstrebt das Werk eine Kompletterfassung aller frühen Realisationen einer welthistorisch bedeutsamen Erfindung in einem begrenzten Zeitraum, für den das im Unterschied zu späteren noch möglich scheint. – Gabryel Greco
Literatur / Quellen:
- Deutsche Staatsbibliothek zu Berlin 1968–2021 ((fehlt in der Bibliografie))