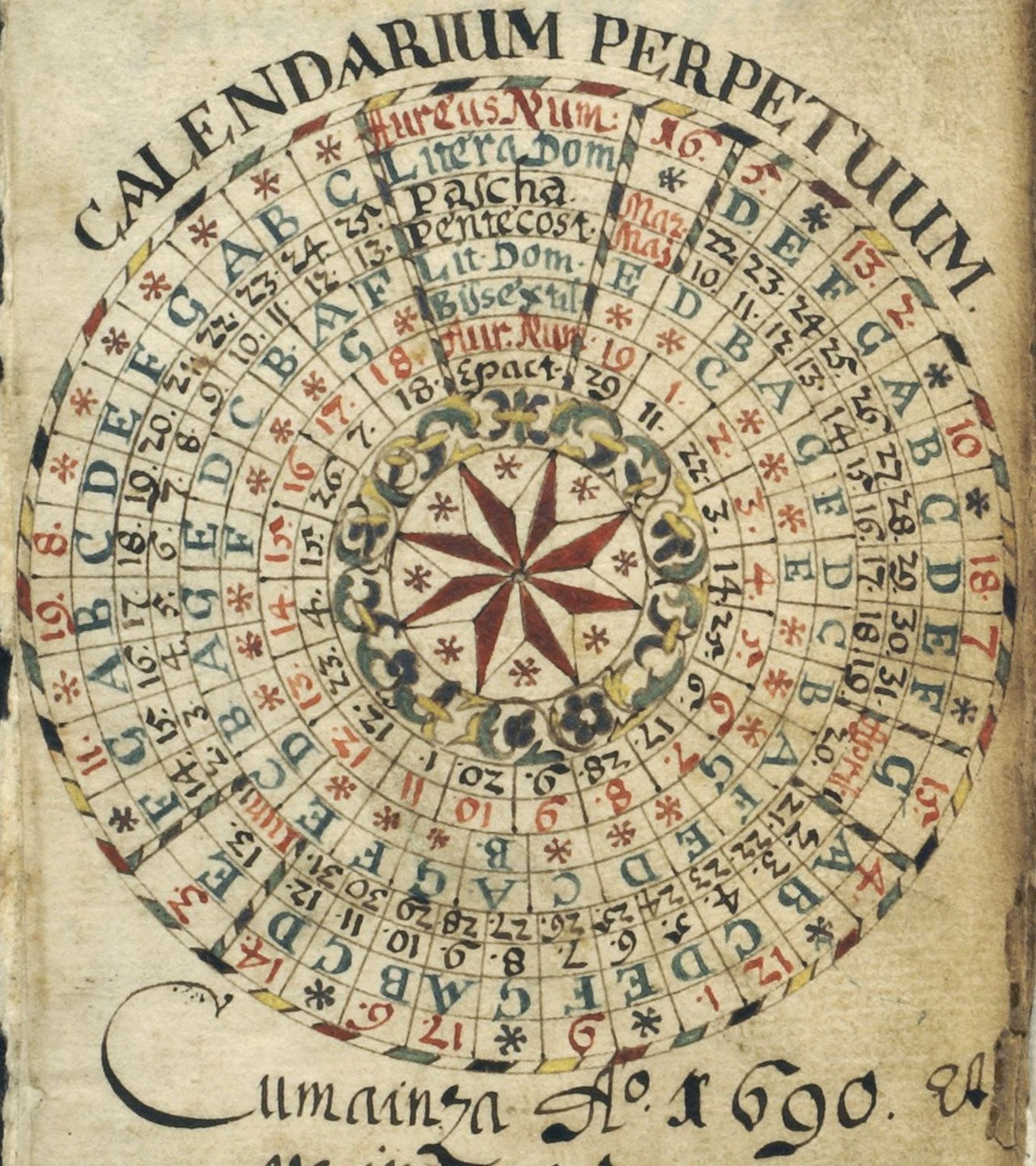Das Gemälde von Pieter Bruegel dem Älteren [Öl auf Holz, 114×116 cm] stellt eine bäuerliche Hochzeitsgesellschaft in Flandern Ende des 16. Jahrhunderts im realistischen Stil dar. Dem Maler wird nachgesagt, sich oft verkleidet auf Bauernhochzeiten eingeschlichen zu haben, um sie zu studieren. Am äußeren rechten Bildrand ist sein Freund Hans Franckert abgebildet, der ihn dabei begleitet haben soll. Das Augenmerk wird zunächst auf zwei Männer im Vordergrund gelenkt, die mit Speisen gefüllte Teller an die lange Festtafel tragen. In vorwiegend warmen Gelb- und Brauntönen werden die Gäste dargestellt, die essen, sich miteinander unterhalten oder sich nach jemandem umdrehen. Die Braut, gekennzeichnet durch eine über ihr hängende Krone, hält die Augen geschlossen und die Hände über dem Bauch gefaltet. Unten links im Gemälde füllt ein Mann leere Krüge, daneben sitzt ein Kind auf dem Boden und hält einen leer gegessenen Teller in den Händen. Die Masse an Menschen und verschiedenen Aktionen erinnert an ein Wimmelbild. Neben dem Festtisch stehen zwei Musiker, dahinter steuern ankommende Gäste durch eine offene Tür in den Raum auf den Tisch zu. Sie geben einen weiteren deutlichen Hinweis auf die Darstellung verschiedener Teilgegenwarten. Bruegels Eigenart, „Bilder aus extrem vielen Einzelszenen zusammenzusetzen“, kommt hier zur Geltung (Müller, Bild und Zeit, S. 72). Mit seinem Gemälde versucht Bruegel, alle Phasen des Fests in einem einzigen Moment zu synthetisieren. Seine Herangehensweise unterscheidet sich beispielweise von seinem Gemälde Kinderspiele dadurch, dass den Figuren durch unterschiedliche Größe und Platzierung eine bestimmte Wertigkeit zugewiesen wird und der Zuschauer einen Anhaltspunkt vorgeschlagen bekommt, in welcher Reihenfolge er die Details wahrnehmen kann. Dagegen erzeugt Kinderspiele mit seinen unzähligen kleinen, gleich großen Figuren eine gewisse Überforderung. „Es ist kaum möglich, den Blick auf dem Bild in seiner Gesamtheit ruhen zu lassen, er wird ständig hin- und hergeschickt.” (Wörsdörfer, Alle im Blick, S. 404). Die Kinderspiele zeigen neunzig unterschiedliche Spiele in einem Bild. In der Bauernhochzeit vereint Bruegel dagegen eine etappenweise Abfolge desselben Ereignisses zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Dass die Wimmelbild-Totalität auch als Entfremdung wahrgenommen werden kann, zeigt die Rezeption der Bauernhochzeit bei Hans Sedlmayr: „Die Wimmelbilderfahrung kennzeichnet hier der unheimliche Eindruck eines Verlusts von Beziehung, mit dem etwas Vertrautes, mithin das Menschsein selbst, fragwürdig wird.” (Wörsdörfer, Alle im Blick, S. 407) – Annika Bäurer
Literatur / Quellen:
- Müller, Jürgen: „Bild und Zeit. Überlegungen zur Zeitgestalt in Pieter Bruegels Bauernhochzeitsmahl“. In: Erzählte Zeit und Gedächtnis. Narrative Strukturen und das Problem der Sinnstiftung im Denkmal, hg. von Pochat und Götz, Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt 2005, S. 72–81.
Weblinks:
🖙 KHM
🖙 Wikipedia