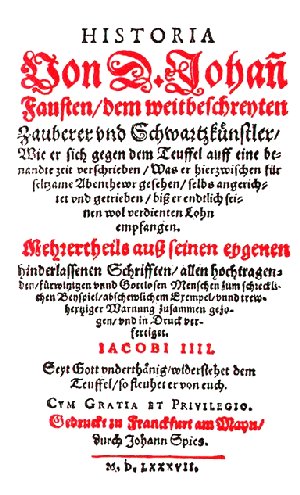Galileo Galilei entwickelt aus dem im Vorjahr erfundenen „niederländischen Fernrohr“ Hans Lipperheys ein Sichtgerät, das Himmelskörper in 14-facher Vergrößerung zu sehen erlaubt. Dieses erste Teleskop besteht aus einem Holzrohr, das außen mit Papier verkleidet ist, einer Zerstreuungslinse und einem Objektiv, welches im Durchmesser 5,1 cm und an der dicksten Stelle 2,1 cm misst. Galileis Weiterentwicklung ist ein Markstein in der Geschichte des panoramatischen Bestrebens, immer genauer und weiter in die Welt und insbesondere ins Weltall auszuschauen, die über viele Zwischenschritte bis zum James-Webb-Weltraumteleskop führt. – Caroline Klein | Johannes Ullmaier
Literatur / Quellen:
- Reeves, Eileen Adair: Galileos glassworks: the telescope and the mirror, Cambridge MA: Harvard University Press 2008