
Nach Tierversuchen entsteht 1971 die erste CT-Aufnahme eines Menschen. Ab 1972 auf dem Markt, verbreitet sich das Bildgebungsverfahren zur Transparentmachung und Erfassung innerkörperlicher Strukturen, das im Unterschied zur Röntgentomografie keine störenden Überlagerungen zeigt, rasch vor allem in der medizinischen Diagnostik, aber auch in der Materialwissenschaft. – Johannes Ullmaier
1969 – Weltzeituhr am Berliner Alexanderplatz

Zehn Meter hoher Eckzylinder, dessen 24 Rechteck-Kanten je eine Zeitzone repräsentieren und jeweils darin liegende Städte aller Kontinente – insgesamt 146 (Stand 2023) – anzeigen. Innerhalb des Zylinders rotiert als eigentliche Uhranzeige ein Ring, der das Wandern der Stunden(zahlen) durch die Zeitzonen darstellt, sodass jederzeit abzulesen ist, wie spät es auf der Erde wo gerade ist. Darüber ist zudem ein beschleunigt rotierendes Planetarium installiert. Neben dem Ostberliner Fernsehturm prominenteste DDR-Manifestation sozialistischer Welteinheits-, Zukunfts- und Technik-Utopie, bis zum Mauerfall in unvermitteltem Kontrast zu den realen Weltbereisungsmöglichkeiten der Bevölkerung; 1985 und 1997 renoviert und aktualisiert; 2023 in einer klimaaktivistischen Impulshandlung mit Sprühfarbe verunstaltet. – Johannes Ullmaier
Weblinks:
1965 – Roman Opalka, 1965/1-?
Wie im Titel angedeutet, beginnt der Künstler Roman Opalka (1931–2011) sein Lebenskunstwerk (oft auch: 1965/1-infinity) im Jahr 1965 und führt es konsequent bis an sein Lebensende fort. Im Zentrum steht die Reihe der natürlichen Zahlen, die er fortlaufend mit dem Pinsel in weißer Farbe auf den grauen Hintergrund einer Großleinwand (196×135 cm) aufträgt, bis diese – von ihm als „Detail“ bezeichnet – jeweils voll ist und die nächste an die Reihe kommt. Parallel erstellt er eine Serie von Fotografien, auf denen jeden Tag die fortgeführte Zahlenreihe sowie der Künstler im Selbstportrait dokumentiert wird. Damit ergibt sich eine durchgängige Spur des Fortschreitens sowohl des Werks als auch des Alterns seines Produzenten. Durch allmähliche Aufhellung des grauen Leinwandhintergrundes nimmt der Kontrast der Zahlen zur Auftragsfläche langsam, aber stetig ab. Das Werk wird immer heller, bis sich die Spur – mit dem Tod des Künstlers – ganz ins Weiß verliert. In Opalkas Verfahren, das mit der Zeit medial immer weiter ausgreift und neben Ausstellungen auch Bücher und Tonträger hervorbringt, manifestieren sich die ideale Unendlichkeit (der Zahlenreihe) und die reale Endlichkeit ihrer Repräsentierbarkeit durch einen Menschen (Roman Opalka). Als Tagebuch der Vergänglichkeit und zugleich zeitloses Denkmal bildet es eine singuläre Antwort auf die existentielle Avantgardefrage nach der Vereinigung von Kunst und Leben. – Marie Matheis | Johannes Ullmaier
Literatur / Quellen:
- Opalka, Roman: 1965/1-?, München: Ottenhausen 1980
Weblinks:
1964 – Kontrollüberwachungsraum in Dr. Strangelove
Die Entwicklung technischer Bildmedien führt dazu, dass die Aussichtsplattform oder der Kartenraum als traditionelle Dispositive der Macht und Kontrolle abgelöst werden durch die moderne, abgeschottete Überwachungszentrale, deren Vielzahl von Bildschirmen nun die Außenwelt repräsentiert. Vorangetrieben durch militärische und industrielle Ordnungssysteme sind Kontrollräume Ausdruck einer kybernetischen Weltanschauung. Interfaces in U-Booten, Schiffen oder Flugzeugen im Zweiten Weltkrieg stellen erste abstrahierte Repräsentationen dar zur besseren Kalkulation, Kontrolle und Steuerung. Die wachsende Rolle von Bildschirmen lässt den Kontrollraum ab den 1960er-Jahren zu einem reizvollen Handlungsraum für Filme verschiedener Genres werden, in dem sich das Medium in einer Art Mise-en-Abyme selbst bespiegelt. Dem Production Designer Ken Adam, der für viele James-Bond-Filme die geheimen Schaltzentralen der Mächtigen und Despoten entwirft, gelingt mit dem „War Room“ eine ikonische Darstellung in Stanley Kubricks Satire Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben, USA 1964). Die panoramatische Funktion der Bildschirme, die den Raum dominieren, dient hier zur Veranschaulichung der Absurditäten des Kalten Krieges. Dabei zeigen Diagramme und Grafiken die Auswirkungen eines atomaren Konfliktes. Die animierten Weltkarten auf den Screens bilden in Echtzeit die Flugrouten der Raketen im Luftraum der Sowjetunion ab. Humoristische Überspitzungen betonen die Irrationalität eines Atomkrieges. Das Filmpublikum kann gleichzeitig die Diskussion der Entscheidungsträger im War Room und die Repräsentation des Konflikts auf den Kontrollbildschirmen hinter ihnen sehen. Nachfolgende technische Entwicklungen führen in Filmen zu immer neuen Demonstrationen einer omnipotenten und postpanoptischen Überwachung in den politischen, militärischen oder ökonomischen Kontrollzentralen, wobei seit den 1990er-Jahren zunehmend digitale, virtuelle, satelliten- und drohnengestützte Repräsentationen den allumfassenden Blick erweitern. – Kaim Bozkurt
Literatur / Quellen:
- Deane, Cormac: „The Control Room: A Media Archaeology“. In: Culture Machine, https://culturemachine.net/vol-16-drone-cultures/the-control-room/, Datum des Zugriffs: 08.04.2024
Weblinks:
1962 – Arno Peters, Histoire Mondiale Synchronoptique
Französische Version der Sychronoptischen Weltgeschichte von Arno Peters, bearbeitet von Robert Minder und von der deutschsprachigen Ausgabe teils signifikant abweichend. Sogar im ‚selben‘ Buch erscheint die Weltgeschichte nirgends auf der Welt identisch, nicht einmal in Nachbarländern. – Johannes Ullmaier
Literatur / Quellen:
- Peters, Arno/Peters, Anneliese: Histoire mondiale synchronoptique, Basel: Editions Académiques de Suisse 1962
Weblinks:
1961 – Buckminster Fuller, World Game
Ursprünglich als Inhalt für Fullers bekannteste geodätische Kuppel – den für die Weltausstellung in Montreal 1967 realisierten Dome – gedacht, dort aber abgelehnt, gelangt die schon zuvor entwickelte Spielidee zur Einübung gesamtweltperspektivischer und kooperativer Problemlösungsstrategien (als Alternative zu den paranoiden Nullsummenspielen des Kalten Krieges) erst in den Folgejahren an verschiedenen Orten und in wechselnden Formaten zur Realisation. – Johannes Ullmaier
Literatur / Quellen:
- Krausse, Joachim/Lichtenstein, Claude: Your Private Sky. R. Buckminster Fuller. Design als Kunst einer Wissenschaft, Zürich: Lars Müller 1999, S. 422–433, 464–499
Weblinks:
1960 – Ted Nelson, Xanadu
Indirekt wirkmächtiges Digital-Konzept zur Kombination der Ideen einer Universalbibliothek (wie in Alexandria) bzw. Universalbibliografie (wie im Mundaneum) mit der einer variablen Zugriffsregistratur (wie Memex). Damit bildet es eine nahe, aber komplexer angelegte Vorstufe der Hypertext-Struktur des Internets. Vor allem gibt es in Nelsons „Docuverse“ noch feste Zitier- und transparente Verlinkungsregeln, ferner Vorkehrungen gegen Plagiate sowie die Idee einer Vergütung für geistige Urheberschaft. All das wurde bei der Einrichtung der Hyperlink-Struktur des Internets pragmatisch eingespart, mit gravierend ambivalenten Folgen für die menschliche Kulturentwicklung. – Johannes Ullmaier
Literatur / Quellen:
- Nelson, Ted: Literary Machines, Sausalito, California: Mindful Press 1993
Weblinks:
1958 – André Waterkeyn, Atomium

Das Brüsseler Wahrzeichen zur Weltausstellung 1958 beherbergt als von innen begehbare Kugelkonstruktion in der obersten Kugel ein Kugelpanorama-Restaurant mit entsprechend rundem Ausblick. – Johannes Ullmaier
Literatur / Quellen:
- Borges, Sofia (Hg.): The Tale of Tomorrow. Utopian Architecture in the Modernist Realm, Berlin: Die Gestalten 2016, S. 118–123
Weblinks:
1957 – Noam Chomsky, Generative Transformationsgrammatik
Die Generative Transformationsgrammatik von Noam Chomsky bildet den bis heute bekanntesten und wirkungsreichsten modernen Versuch einer Universalgrammatik. Auf Basis genereller Regelannahmen wird ein abstraktes, ihrem theoretischen Postulat zufolge für alle menschlichen Sprachen gültiges Generierungsschema ausgewiesen, das beschreibt, wie Wörter und Phrasen kombiniert und komplexe Sätze gebildet, analysiert und verstanden werden können. Aus diesen universellen Prinzipien der Spracherzeugung heraus sollen die Strukturen und Regeln für alle einzelnen historisch evolvierten (und ferner evolvierenden) Sprachen weltweit, ob natürlich oder künstlich, transformativ hergeleitet werden können. An der Berechtigung dieses theoretischen Allerfassungsanspruchs sind seither aus verschiedenen Richtungen massive Zweifel laut worden. – Hannah Bartölke | Johannes Ullmaier
Literatur / Quellen:
- Chomsky, Noam: Syntactic Structures, Den Haag: Mouton 1957
Weblinks:
1952 – Arno und Anneliese Peters, Synchronoptische Weltgeschichte
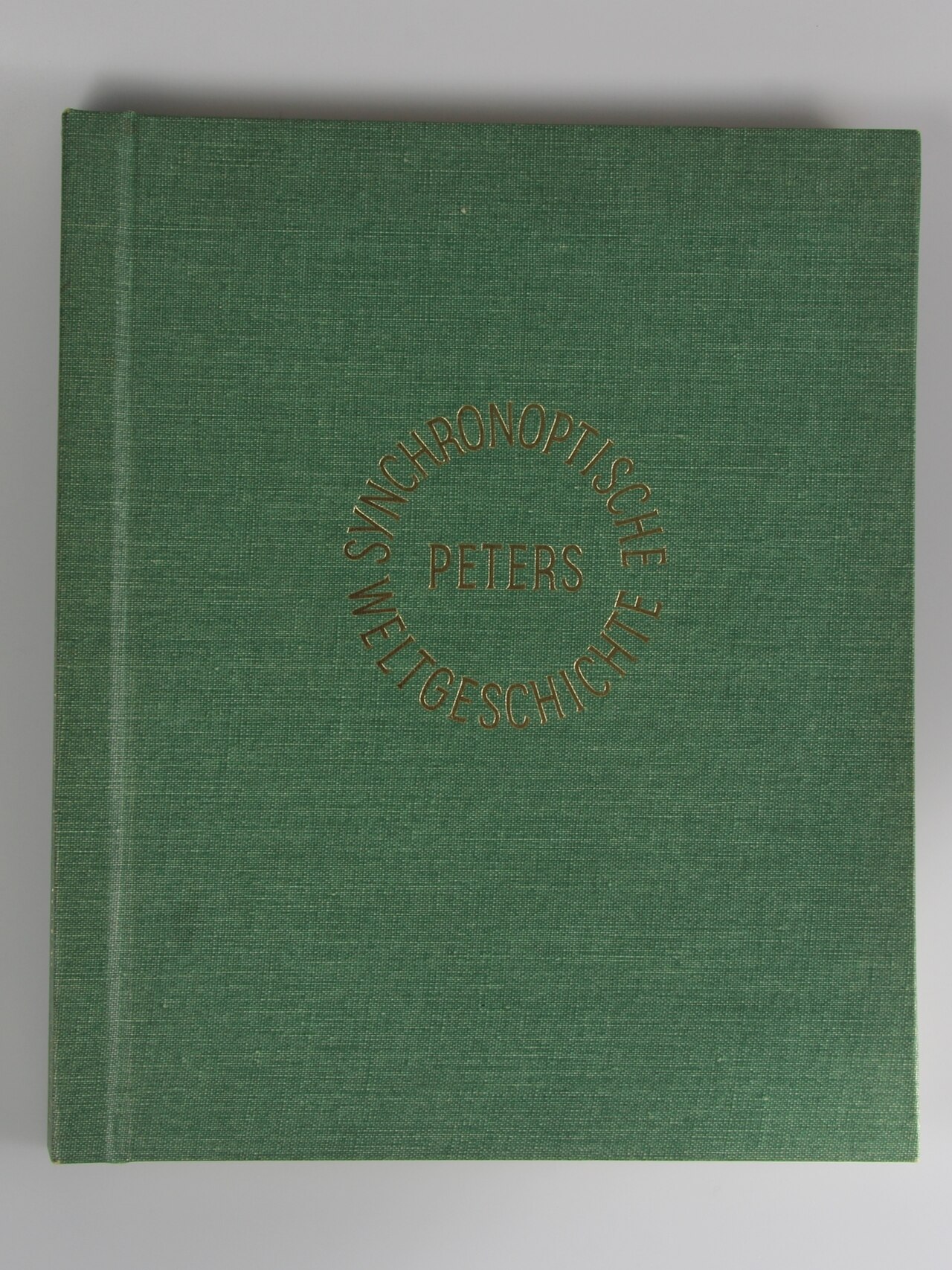
Zeitkartografische Form der Weltgeschichtsdarbietung als großformatiges Aufklapp-Kartenwerk. Die vertikal in mehrere Themenstreifen untergliederten und horizontal die Kalenderjahresfolge repräsentierenden ca. 12.000 Ereignis-Kästchen sowie die im Zentrum übereinandergelagerten ‚Lebensstreifen‘ prägender Persönlichkeiten sollen ermöglichen, die Geschichte der menschlichen Zivilisation von ca. 3000 vor Chr. bis zum Erscheinungszeitpunkt diachron sowie synchron in großen Perspektivzusammenhängen zu erfassen, möglichst ‚auf einen Blick‘. Anschließend an frühe, teils heftige, aber verbreitungsfördernde Kontroversen um die Auswahl und politische Ausrichtung der Einträge erscheint das Werk über Jahrzehnte hinweg in immer neuen, um ein bis zu 10.000 Stichwörter umfassendes Register angereicherten Auflagen; 2010 wird es per CD-ROM in die Digitalepoche und 2017 via Herodot in die Onlinesphäre überführt. – Johannes Ullmaier
Literatur / Quellen:
- Peters, Arno/Peters, Anneliese: Synchronoptische Weltgeschichte, Frankfurt am Main: Universum 1952
- Kuchenbuch, David: Welt-Bildner. Arno Peters, Richard Buckminster Fuller und die Medien des Globalismus, 1940–2000, Köln: Böhlau 2021, S. 253–286