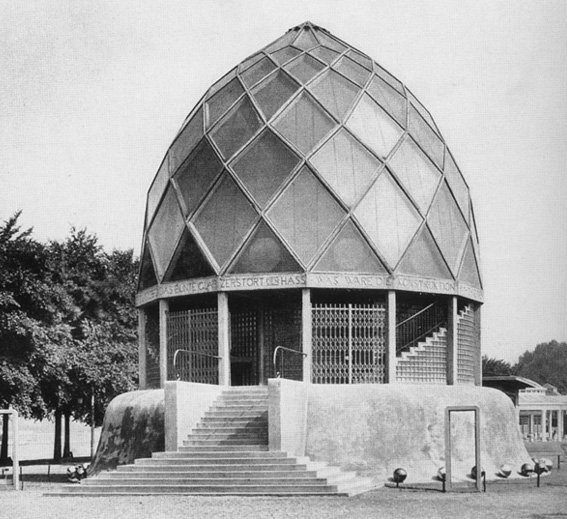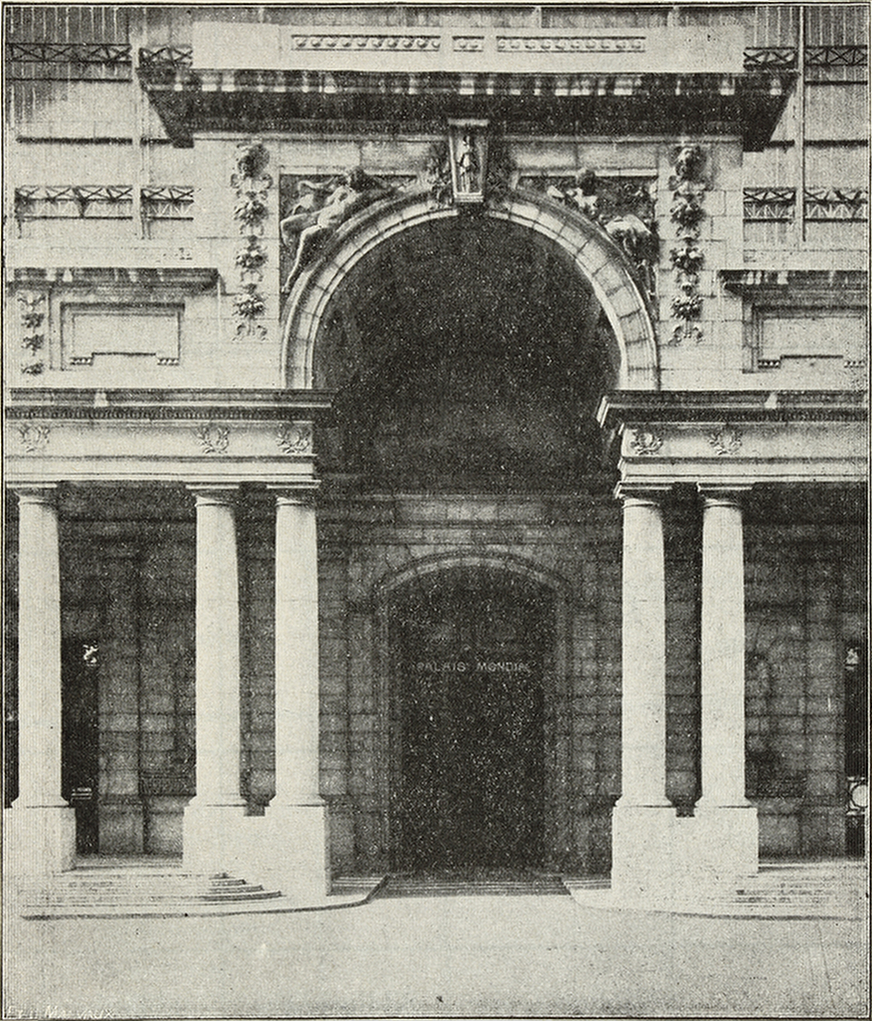Die erste filmische Luftaufnahme findet sich in dem einminütigen Panorama pris d’un ballon captif (FR 1897/1898), einer Produktion der Gebrüder Lumière. Aus der Perspektive eines aufsteigenden Ballons sind eine verwackelte, kleiner werdende Menschenmenge sowie Straßen und Dächer zu sehen. Die Vertikalität des Blickes und das Fehlen einer Horizontlinie eröffnen im Gegensatz zur Alltagswahrnehmung eine ungewohnte und deutlich abstraktere Sicht auf die abgebildete Realität. Luftaufnahmen werden nicht nur durch die technischen Bedingungen des Flugobjektes (Ballon, Flugzeug, Hubschrauber, etc.) ermöglicht, sondern auch von ihrem jeweiligen Bewegungsmodus geprägt. Heutzutage können reale Draufsicht-Bilder durch ferngesteuerte Drohnen oder Satelliten aufgenommen werden. Der militärische Kontext, in dem Luftaufnahmen oftmals entstehen und zum Einsatz kommen, ist integraler Bestandteil ihrer Entwicklungsgeschichte. Dieser ist indirekt auch in En dirigeable sur les champs de bataille (FR 1919) präsent. Der Film basiert auf einer in den Jahren 1918–19 aufgenommenen Serie von Luftaufnahmen, gedreht von Lucien Le Saint, einem im kinematografischen Dienst der französischen Armee stehenden Kameramann. Sie dienen der filmischen Kartografierung der im Ersten Weltkrieg zerstörten Gebiete für den Wiederaufbau. Die von einem Ballon aus aufgenommenen, schräg zum Boden gerichteten und ständig bewegten Bilder zeigen ein Panorama der versehrten französischen und belgischen Städte und Landschaften. Der Blick von oben, der im Krieg zur Feindaufklärung, Planung und Durchführung militärischer Operationen funktionalisiert wurde, bezeugt und dokumentiert hier die Folgen der Zerstörung. – Johannes Noss
Literatur / Quellen:
- Castro, Teresa: „Aerial views and cinematism“. In: Seeing from above: The aerial view in visual culture, hg. von Mark Dorrian und Frédéric Pousin, London: Bloomsbury 2013, S. 118–133, S. 118–133
Weblinks:
🖙 Panorama pris d’un ballon captif
🖙 YouTube: En Dirigeable sur les champs de bataille (1918) – Ausschnitt