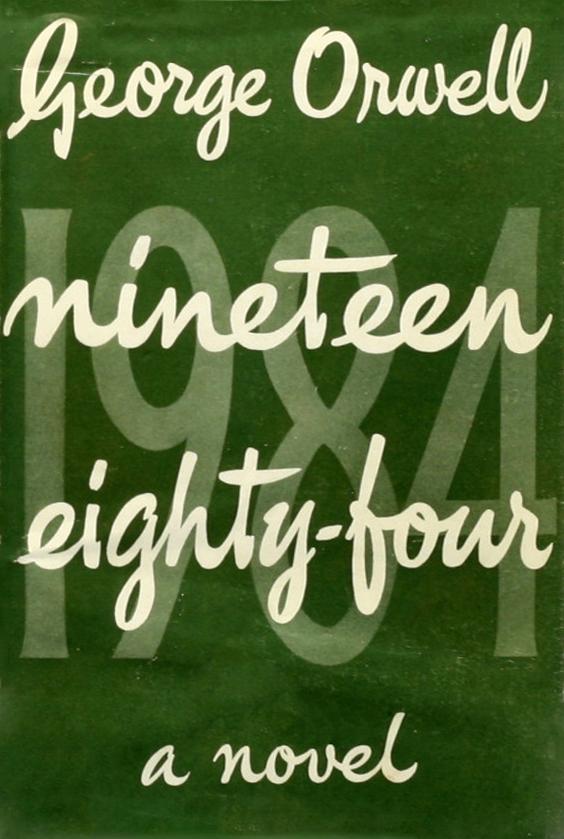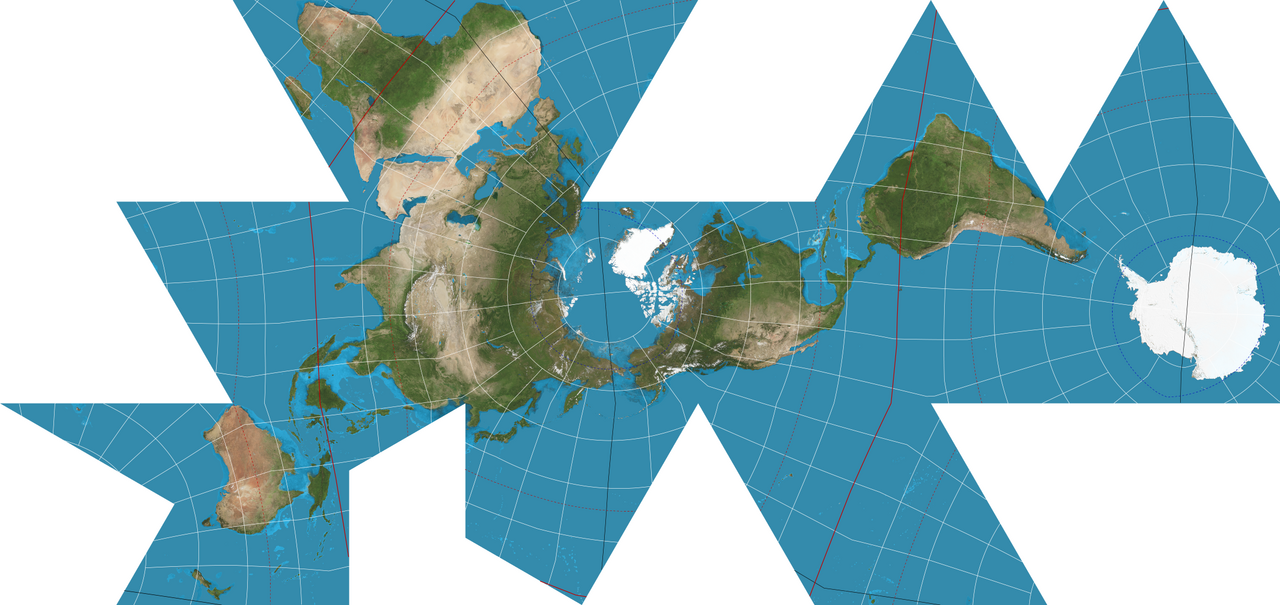In kaum anderthalb Minuten zählt der Harvard-Mathematiker und Klavier-Kabarettist Tom Lehrer (1928–2025) in seinem Lied The Elements (musikalisch eine Adaption des Major-General’s Songs von Gilbert and Sullivan) sämtliche chemischen Grundstoffe auf, die zum damaligen Zeitpunkt im Periodensystem der Elemente erfasst sind – eine spielerische Symbiose von Musik, Artistik, Wissenschaft und Unterhaltung. Obwohl sich Lehrer bei seiner Aufzählung nicht an die strukturierende Systemordnung nach aufsteigender Kernladung hält, sondern die Elemente(nnamen) eher nach metrischen Gesichtspunkten gruppiert und dabei bevorzugt Alliterationen häuft („…praseodymium and platinum, plutonium, / Palladium, promethium, potassium, polonium,/ And tantalum, technetium, titanium, tellurium, / And cadmium and calcium and chromium and curium…“), gewinnt sein mnemotechnischer Marathon und artikulatorischer Sprint zur Vollständigkeit aller Materie in der rasenden Verdichtung gleichermaßen komische wie – zumindest potentiell – didaktische Prägnanz. Denn obwohl das ‚alles viel zu schnell geht‘, wird es so doch besser merkbar.
Dass der Anspruch auf Vollständigkeit – wie bei allen realitätsbezogenen Allerfassungen – durch die Entdeckung neuer Elemente konterkariert werden kann, wird von Lehrer in späteren Versionen des (auf dem 1959er-Album An Evening Wasted With Tom Lehrer erstmals erschienenen) Stücks selbst pointiert: In seiner Kopenhagener Performance von 1967 unterbricht er (ca. ab Min. 1.00) den Fluss und fügt gesprochen ein: „A new one was dicovered, since the song was written, it is called Laurencium“ – um die Temporalität der menschlichen Materieauffassung nach Abschluss des Lieds in einem Mikro-Nachspiel auch zur anderen Seite der Historie hin zu spiegeln: „You may be interested to know that there is an older, much earlier version of hat song, which is due to Aristotle, and which goes like this: There’s earth and air and fire and water.“ – Lena-Maria Weiß / Johannes Ullmaier
Weblinks:
🖙 Discogs-Eintrag zur LP-Veröffentlichung
🖙 Perfomance (1967)