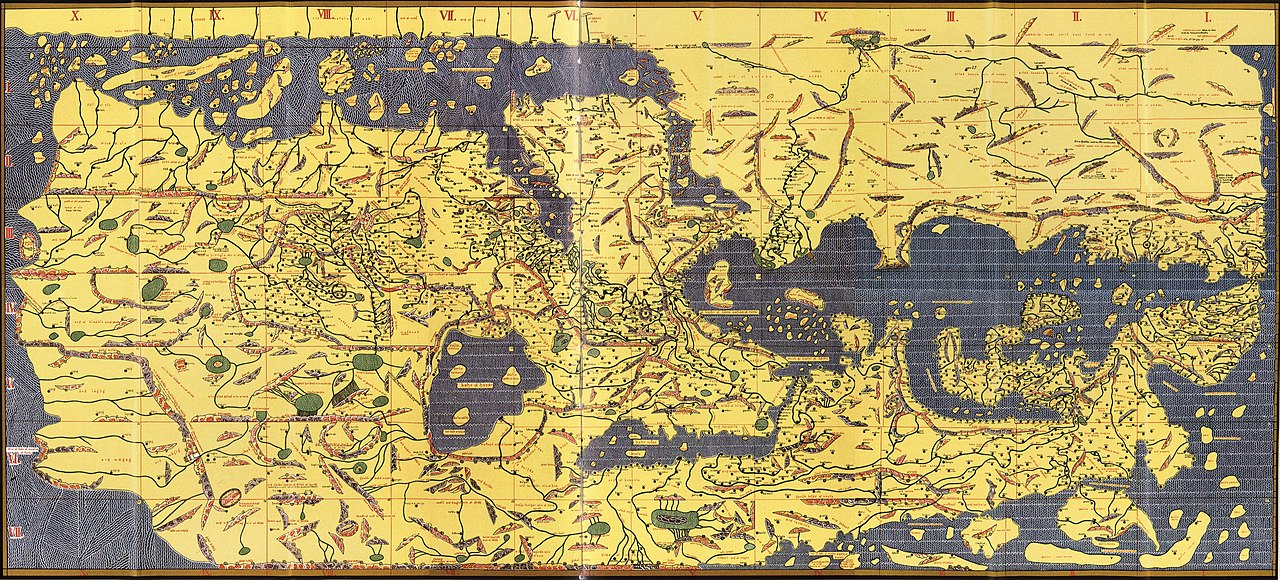Wie der Turmbau zu Babel indiziert auch die Urszene abendländischer Flugpanoramatik (Buch VIII, V 183–235) mit der Begehrensmacht zugleich die Zweischneidigkeit menschlicher Himmelsaufbrüche. Daedalus’ aviatische Technik ermöglicht ihm und seinem Sohn Icarus die erhebende Befreiung aus der kretischen Verbannung. Doch die Lust am Aufstieg mündet in Kontrollverlust. Die Kernpassage gestaltet zudem den Perspektivwechsel vom situierten Aufschauen erdgebundener Beobachter zu den vermeintlich göttlichen Fliegern hin zu deren (quasi-)göttlicher Überschau: „Wer sie erblickt, ein Fischer vielleicht, der mit schwankender Rute angelt, ein Hirte, gelehnt auf den Stab, auf die Sterzen gestützt, ein Pflüger, sie schauen und staunen und glauben Götter zu sehen, da durch den Äther sie nahn. Schon liegt zur Linken der Juno heiliges Samos, liegt im Rücken Delos und Paros, rechts schon Lebinthus erscheint und das honigreiche Calymne, als der Knabe beginnt, sich des kühnen Flugs zu freuen, als er den [väterlichen] Führer verläßt und im Drang, sich zum Himmel zu heben, höher den Weg sich wählt.“ Weil er der Sonne zu nahe kommt, schmilzt das Wachs, das die Flügel mit seinem Körper verbindet, und er stürzt ins Meer. „‚Icarus!‘, ruft [Dedalus], ‚wo bist du? Wo soll in der Welt ich dich suchen?‘“ (Ovid, Metamorphosen, S. 287) – Johannes Ullmaier
Literatur / Quellen:
- Ovid: Metamorphosen, Stuttgart: Reclam 1994, S. 285–287
Weblinks:
🖙 Wikipedia