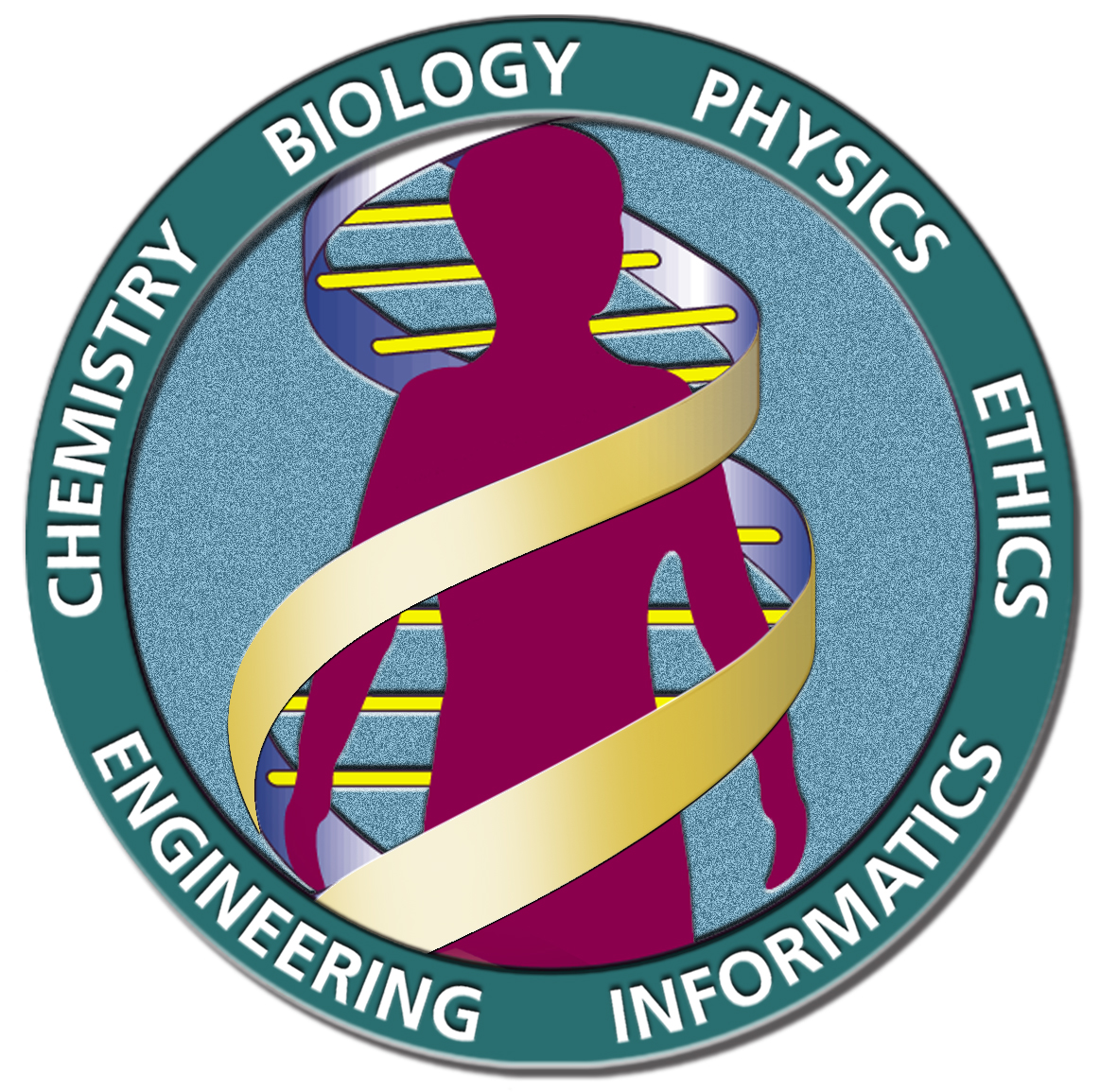Nach dem Weltrechtsprinzip (auch Universalitätsprinzip genannt) ist jeder Staat für die Verfolgung aller Straftaten besonders schwerwiegender Art (z.B. Völkermord) zuständig, unabhängig davon, wo, von wem und zu wessen Lasten sie begangen wurden. Es steht im Widerspruch zu dem bislang vorherrschenden Souveränitätsprinzip, nach dem jeder Staat allein für die Verfolgung von auf seinem Gebiet (Territorialitätsgrundsatz) sowie durch oder an seinen Staatsangehörigen (Personalitätsgrundsatz) begangenen Straftaten legitimiert ist, während jede darüber hinausgehende Strafverfolgung als Eingriff in die Souveränität des betroffenen anderen Staates angesehen wird. (Beispiele für das Personalitätsprinzip: Deutschland darf einen Deutschen verfolgen, der im Ausland einen Ausländer getötet hat sowie auch einen Ausländer, der im Ausland einen Deutschen getötet hat, soweit der Täter sich in Deutschland aufhält.)
Einen gewissen Vorläufer des Weltrechtsprinzips kann man in der seit Jahrhunderten üblichen weltweiten Verfolgung von Piraterie sehen. Allerdings stand diese nominell nicht im Widerspruch zum Souveränitätsprinzip, da die Piraterie auf dem staatenlosen Gebiet der Weltmeere stattfand und alle (seefahrenden) Nationen sich gleichermaßen bedroht sahen. (Jedenfalls in der Theorie; in der Praxis gab es durchaus Unterstützung mancher Nationen für bestimmte Piraten, die auf Konkurrenten angesetzt wurden.)
In Folge der Verbrechen des Dritten Reiches und deren Aufarbeitung in den Nürnberger Prozessen verbreitete sich jedoch die Überzeugung, dass auch Staatenlenker und deren vollstreckende Organe sich nicht vor der Ahndung ihrer Taten sicher fühlen dürfen. Daher sollen, wenn eine solche Verfolgung im Tatortstaat nicht gewährleistet ist, andere Staaten oder supranationale Institutionen tätig werden können. Diese Überlegungen resultierten 2002 in der Einrichtung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH). Zudem schufen etliche Länder in ihren nationalen Rechtsordnungen Kompetenznormen, um in Ergänzung zum IStGH tätig werden zu können. In Deutschland wurden 2002 hierfür das Grundgesetz geändert (Art. 96 Abs. 5 GG) und das Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) eingeführt. Seitdem hat es etliche Verurteilungen, insbesondere wegen Taten in Ruanda und Syrien gegeben, da die Täter in Deutschland betroffen wurden.
Allerdings erlangte das Universalitätsprinzip nie universale Geltung. Große internationale Player wie die U.S.A und China waren von vorneherein nicht bereit, den IStGH zu unterstützen und eigene Staatsbürger der etwaigen Verfolgung durch diesen auszusetzen. Russland war kurzzeitig Mitglied, ist aber alsbald wieder aus den internationalen Vereinbarungen ausgestiegen. Zudem sieht sich das Weltrechtsprinzip in neuerer Zeit zunehmenden Angriffen ausgesetzt. Die U.S.A. gehen in der zweiten Amtszeit Trumps sogar soweit, Mitarbeiter des IStGH unter Sanktionsdrohung zu stellen, soweit deren Tätigkeit Interessen der U.S.A. berühren könnten. Zugleich ist das Universalitätsprinzip grundsätzlicher Kritik von Seiten postkolonialer Theorien ausgesetzt: Der Westen versuche, mithilfe der internationalen Jurisdiktion seine Ambitionen umzusetzen. Die Kritik wird dann wirkmächtig, wenn sich Staatenlenker unter Berufung auf sie einer möglichen Verfolgung zu entziehen suchen. – Ralf Wehowsky
Literatur / Quellen:
- Stuckenberg, Carl-Friedrich: „Weltrechtsprinzip und (Völker-)Strafrecht“. In: Bonner Rechtsjournal 2 (2020), S. 102–108. (https://www.bonner-rechtsjournal.de/fileadmin/pdf/Artikel/2020_02/BRJ_102_2020_Stuckenberg.pdf)
- Wilhelmi, Theresa: Das Weltrechtsprinzip im internationalen Privat- und Strafrecht, Frankfurt am Main: Peter Lang 2007.
Weblinks:
🖙 Wikipedia
🖙 Wikipedia IStGH