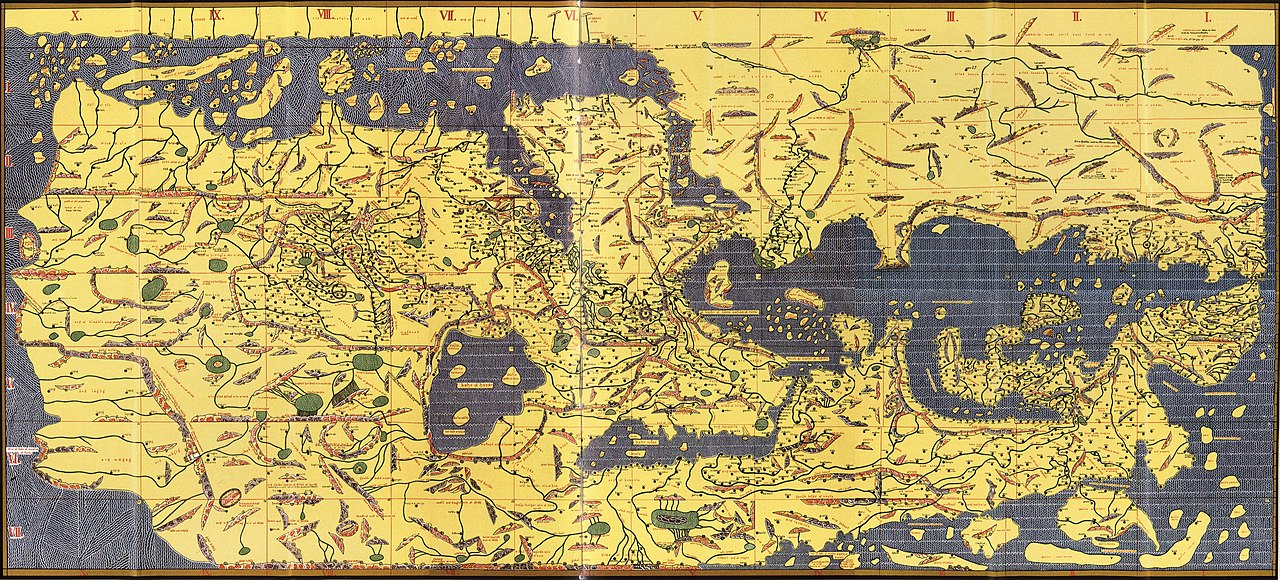Grundlegend für Plotins Philosophie ist das System der drei Hypostasen, in dem der Philosoph eine hierarchische Gesamtordnung allen Seins anlegt. Dabei ist im Grundsatz zwischen der physischen Welt, die alle sinnlich erfahrbare Materie umfasst und auf der niedrigsten Ebene angesiedelt ist, sowie dem geistigen Bereich zu unterscheiden. Letzterer gliedert sich in die Seele, den Geist (nous) und das Eine. Während die Seele innerhalb der unmittelbaren Erfahrungswelt agiert, steht der nous in der Tradition der platonischen Ideenlehre und ist zur höchsten Form der intelligiblen Erkenntnis fähig. Der Geist erkennt sämtliche Formen und darüber hinaus auch sich selbst. Hierin sieht der Gelehrte eine Problematik, denn innerhalb des Erkenntnisprozesses sei im Mindesten die „Zweiheit“ (Plotin, Schriften, V 6 [24],1) von „Gedachte[m] und Denkende[m]“ (V 6 [24],1) enthalten. Diese Vielfalt muss nach Plotin durch eine Einheit „zusammengehalten“ (VI 9 [2]) werden. Da die Pluralität andernfalls nicht stabil sei, wird dieses Eine als Einheit und Allursache allen Seins vorausgesetzt. Es existiert „jenseits des Seins und des Erkennens“ (VI 8 [39],16). Aus diesem Urgrund gehen alle anderen Instanzen des hypostatischen Modells hervor, denn nach Plotin „würde ja überhaupt kein Ding existieren[,] wenn das Eine bei sich stehen bliebe und es gäbe nicht die Vielfalt unserer Erdendinge“.
Nun stellt sich die Frage, wie jenes „Einfachste von allen Wesen“ (V 3 [13]) gedacht oder beschrieben werden könnte. Hier entwickelt Plotin eine negative Theologie, indem er darauf hinweist, dass positive Aussagen über das Eine nicht zulässig seien. So identifiziert Plotin die Allursache zwar mit dem Guten, doch sieht er in einer Kopula wie ‚Gott ist gut‘ bereits eine Zweiheit und Komplexität angelegt, die der Einheit des Einen widerspreche. Ergo kann das Eine nur durch das, „was es nicht ist“ (Gertz, Plotinos 990), verständlich gemacht werden. Plotin resümiert: „Somit haben wir es, daß wir wohl über es, nicht aber es aussagen können. Wir sagen ja aus, was es nicht ist; und was es ist, das sagen wir nicht aus“ (V 3 [49],14). Diese Unbeschreibbarkeit resultiert aus der Tatsache, dass der Geist die Allursache lediglich „von den Dingen aus, die später sind als es“ (V 3 [49],14), zu erkennen vermag. In der weiteren neuplatonischen Tradition arbeitet Pseudo-Dionysius Areopagita den Ansatz einer negative Theologie – von den Enneaden ausgehend – in einer Weise aus, die insbesondere hinsichtlich des transzendenten Einen und den daraus folgenden erkenntnistheoretischen Problemen Parallelen zu Plotin aufweist. Doch schon bei diesem ist die fundamentale Dialektik von Allbegriff und Allentfaltung eindringlich beschrieben. – Niclas Stahlhofen
Literatur / Quellen:
- Plotinus: Plotins Schriften. Übers. v. Richard Harder, neubearb. m. griech. Lesetext u. Anm. fortgeführt v. Rudolf Beutler u. Willy Theiler. 6 Bde (in 11 Teilbd.). Hamburg: Meiner 1956–1971.
- Gertz, Sebastian: „Plotinos“. In: Reallexikon für Antike und Christentum. Bd. 17, Stuttgart: Hiersemann 2016, S. 988–1009.
- Halfwassen, Jens: Plotin und der Neuplatonismus, München: Beck 2004.
- Tornau, Christian (Hg.): Plotin Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart: Metzler 2024.
- Tornau, Christian: Plotin Enneaden VI 4–5 [22–23]. Ein Kommentar, Stuttgart & Leipzig: Teubner 1998.
Weblinks:
🖙 Wikipedia